Justus
Wir hatten ja schon einige Texte zum Italien der 70er, die meisten davon waren Übersetzungen von uns. Manches Gold hebt mensch allerdings, wenn er/sie/es gar nicht auf der Suche danach ist, quasi zufällig darüber stolpert. So wie mit diesem wunderbaren Überblick über den “langen Sommer der Autonomie”, der in ‘Feierabend !’, einem libertären Heft aus Leipzig, das von 2014 – 2016 verlegt wurde, erschien, und dessen digitale Hinterlassenschaft zum Glück erhalten geblieben ist. Wir haben die insgesamt sechs Beiträge bearbeitet, mit Bildern versehen und zusammengefasst. Viel Vergnügen bei der Lektüre. Und nachträglich Dank an Justus. Sunzi Bingfa
Operaismus für Anfänger*innen (Teil 1)
Operaismus? Mit dem Begriff dürften wohl die meisten (auch die meisten linken Aktivist*innen) erst mal wenig anfangen können. Operaismus, das war doch so eine obskure linke Theorieströmung, die im Italien der 60er und 70er eine gewisse Rolle spielte? Genaueres wissen die meisten leider nicht.
Bekannter ist da schon der „Post-Operaismus“, der dank Antonio Negris und Michael Hardts Theorie-Bestseller „Empire“ nicht nur in Teilen der globalisierungskritischen Linken, sondern auch in universitären Kreisen und im bürgerlichen Feuilleton eine Weile als der letzte heiße Scheiß gehandelt wurde.
Mit Negri werden wir uns im weiteren Verlauf dieser Artikelreihe noch auseinandersetzen. Im Zentrum stehen soll er allerdings nicht. Schließlich gibt es weitaus interessantere und wichtigere Theoretiker*innen des Operaismus – denen wollen wir uns in dieser und den kommenden Feierabend! -Ausgaben widmen.
Ursprünglich war „Operaismus“ (vom italienischen „operaio“, „Arbeiter“ abgeleitet) eher ein Schimpfwort, etwa im Sinne von „Arbeitertümelei“, als Vorwurf einer übergroßen Fixierung auf die Fabrik Arbeiterschaft. Freilich machte genau das die Originalität der frühen operaistischen Theoretiker*innen aus, dass sie sich mit den Verhältnissen in den Fabriken beschäftigten und die Arbeiter*innen als Subjekte ernst nahmen. Der Operaismus war damit auch ein Versuch, die marxistische Theorie von unten her zu erneuern, sie auf das Italien der Nachkriegszeit anzuwenden, um sie an den realen Verhältnissen zu prüfen und zu aktualisieren.
Die Theoriegeschichte des Operaismus ist so zugleich auch eine Geschichte der Klassenkämpfe im Italien der 1960er und 70er Jahre. Das macht den Versuch einer vorläufigen Definition nicht gerade einfacher: Das operaistische Denken lässt sich – wenigstens in seinen besseren Momenten – eben nicht von seinem Gegenstand trennen und auf eine Anzahl von Begrifflichkeiten und Lehrsätzen herunterstutzen. Die zweite Schwierigkeit besteht darin, dass auch der Operaismus sich im Laufe der Entwicklung drastisch veränderte: In den frühen 60er Jahren war es noch eine recht kleine Zahl von Linksradikalen, die als „Operaisten“ verunglimpft wurden. In den späten 60ern verband sich der Begriff mit einer breiten sozialen Bewegung, der sogenannten Autonomia Operaia (Arbeiterautonomie), die sich spätestens im ‚Heißen Herbst’ 1969 eindrucksvoll zu Wort meldete. Eine neue Generation junger Arbeiter*innen rebellierte gegen die Arbeit und brachte mit wilden Streiks die Machtverhältnisse in den norditalienischen Fabriken ins Wanken.
Und wenn wir uns die 70er Jahre anschauen, wird die Sache noch unübersichtlicher: Während in den Fabriken wieder halbwegs Ruhe einkehrte, weiteten sich die Kämpfe auf neue Bereiche aus, neue Gruppen kamen hinzu: Frauenbewegung, jugendliche Erwerbslose, Hausbesetzer*innen… Die Gruppe Lotta Femminista entwickelte ausgehend von der operaistischen Arbeitskritik eine Kritik der Hausarbeit. Andere Theoretiker*innen (allen voran Toni Negri) verloren angesichts der verwirrenden Vielfalt dieser neuen autonomen Bewegung endgültig den Kopf. Dies soll in den letzten beiden Teilen dieser Artikelreihe das Thema sein.
Ein weites Feld also – aber die Auseinandersetzung lohnt sich. Schließlich ist auch unsere heutige Realität noch durch die Klassenkämpfe der 60er und 70er Jahre und deren Folgewirkungen geprägt (das reicht bis hin zur mittlerweile chronischen Finanzkrise). Und von den Analysen und Untersuchungen der Operaist_innen lässt sich auch heute noch einiges über die innere Dynamik dieser Kämpfe lernen. Das wäre gerade heute wichtig, wo ein Großteil der bundesdeutschen Linken längst nicht mehr von Klassenverhältnissen redet und sich passend dazu in bequemer Hoffnungslosigkeit eingerichtet hat. Die operaistische Untersuchung könnte da den Blick dafür öffnen, dass wir längst nicht so machtlos sind, wie wir zu sein glauben. Zu diesem Punkt haben die Operaist*innen, trotz der manchmal trockenen und komplizierten Sprache ihrer Texte, einiges zu sagen. Aber genug der langen Vorrede – here we go.
Das große Wachstum
Als Geburtsstunde des Operaismus kann wohl unbestritten das Jahr 1961 gelten – damals erschien in Turin die erste Ausgabe der Quaderni Rossi (Roten Hefte). Die treibende Kraft hinter diesem Zeitungsprojekt war Raniero Panzieri, ein langjähriges Mitglied der PSI (Partido Socialista Italiano, Sozialistische Partei Italiens). Um Panzieri und die Quaderni Rossi herum sammelte sich eine kleine Gruppe von Intellektuellen, zum Großteil unzufriedene Mitglieder der PSI bzw. der PCI (Partito Communista Italiano, Kommunistische Partei Italiens). Ziel dieser Gruppe war es, die neuen Klassenkonflikte, die sich in der italienischen Industrie andeuteten, genauer zu untersuchen.
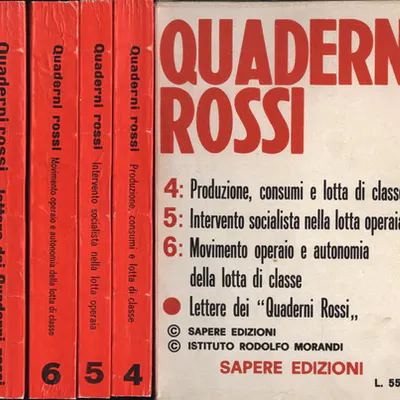
In den 1950er Jahren hatte Italien eine Phase der raschen nachholenden Industrialisierung durchgemacht. Zwar lag die Produktion nach Ende des 2. Weltkriegs am Boden. Aber schon 1949 hatte sie wieder das Vorkriegsniveau erreicht. Gefördert durch US-amerikanische Aufbauhilfe und den Beitritt Italiens zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, setzte ein rasantes Wachstum ein. Die veraltete Infrastruktur des Landes wurde erneuert, der Wohnungsbau boomte ebenso wie die Petrochemie, die Stahl- und die Autoindustrie. Allein von 1949 bis 1953 stieg die Produktion um 63%, und dann von 1953 bis 1961 noch mal um 100%. Dieses Wachstum konzentrierte sich freilich vor allem auf die traditionelle Industrieregion im Norden Italiens. Der seit jeher von der Landwirtschaft geprägte Süden profitierte dagegen kaum vom allgemeinen Aufschwung.
Auch die Parteien der Linken, die PCI und die PSI, unterstützten vorbehaltlos den „Wiederaufbau“. Dabei hielten sie zwar am Fernziel der „Demokratisierung“ (so der offizielle Parteijargon – gemeint war die Verstaatlichung) der Industrie fest, bis auf weiteres galt ihnen aber erstmal die Steigerung der Produktion als die dringendste Aufgabe. Durch ein rasches Wirtschaftswachstum sollte der Lebensstandard der proletarischen Wählerschaft gehoben, aber auch den bürgerlichen Parteien gegenüber Koalitionsfähigkeit demonstriert werden. Auch die von der PCI und PSI kontrollierten Gewerkschaften ordneten sich deren Linie unter – wo sich Widerstand unter den Arbeiter*innen regte, traten die Organisationen der alten Arbeiterbewegung immer offensichtlicher als Ordnungsmacht im Sinne des Staates und der Unternehmer auf.
Zugleich blieben auch die PSI und PCI nicht von der tiefen Orientierungskrise verschont, in die praktisch alle Parteien der Kommunistischen Internationalen zu dieser Zeit gerieten. Das Jahr 1956 bildete dabei den Wendepunkt. Auf dem 20. Parteitag der KPdSU, der sowjetischen kommunistischen Partei, machte Chruschtschow erstmals die Verbrechen des Stalinismus öffentlich. Und auch die Niederschlagung des proletarischen Aufstands in Ungarn im selben Jahr trug wesentlich dazu bei, den sowjetischen Realsozialismus als Leitbild fragwürdig zu machen.
Diese Ereignisse lösten auch in der PCI und PSI heftige Debatten aus, die freilich in erster Linie nur dazu beitrugen, die schrittweise Sozialdemokratisierung beider Parteien nur noch weiter zu beschleunigen. Andererseits eröffnete die ideologische Verunsicherung aber auch Spielräume für weit tiefgreifendere kritische Auseinandersetzungen. In diesen spielte Raniero Panzieri eine wichtige Rolle, zumal er dafür genau in der richtigen Position war: Mitte der 1950er saß er nicht nur im Zentralkomitee der PSI, sondern auch in der Chefredaktion der parteieigenen Theoriezeitschrift Mondo Operaio. Dort veröffentlichte Panzieri 1958 auch seine „Sieben Thesen zur Frage der Arbeiterkontrolle“ (1), in denen er harte Kritik am „italienischen Weg zum Sozialismus“ übte. Panzieri ging dabei von einem Konzept der Selbstverwaltung aus – „Sozialismus“ bedeutete für ihn die Kontrolle und Verwaltung der Produktion durch die Arbeiter*innen selbst. Dieses Ziel, so erklärte er, lasse sich aber nicht auf rein parlamentarischem Wege erreichen. Wer etwas anderes behaupte, falle damit in bürgerliche Mystifikationen zurück, welche „den bürgerlich-repräsentativen Staat nicht als das darstellen, was er ist, d.h. als einen Klassenstaat, sondern als einen über den Klassen stehenden Staat“. Der Staat war für Panzieri eben kein neutrales Terrain, kein reines Instrument, das sich einfach übernehmen und für beliebige Zwecke einsetzen lasse.
Vielmehr, so forderte Panzieri, müsse das Proletariat sich im Zuge seiner Kämpfe eigene Institutionen aufbauen, und zwar „in der ökonomischen Sphäre“, wo der wirkliche Ursprung der Macht liege. Von dieser (rätekommunistischen) Position her kritisierte Panzieri auch das leninistische Konzept der Avantgarde-Partei, „die naive, aus der Tradition der Aufklärung stammende Vorstellung, das Proletariat müsse zur Machtausübung ‚erzogen’ werden.“ Von entscheidender Bedeutung war für ihn die „Sicherung der revolutionären Autonomie des Proletariats […] gegen die reformistische Unterwerfung und gegen die Konzeption einer ‚Führung’ (führende Partei, führender Staat)“. Die Partei sollte nur ein „Instrument“ der Klassenbewegung sein, keine paternalistische Führung ausüben, sondern lediglich „als Impulsgeber und zur Unterstützung der Organisationen, in denen sich die Klasseneinheit artikuliert“, auftreten. Panzieri rückte also das Proletariat an die erste Stelle und erwies sich so tatsächlich als guter Arbeitertümler im Sinne des eingangs erwähnten Vorwurfs. Eine sicherlich sympathische, wenn auch keineswegs widerspruchsfreie Position: Für das angepeilte Ziel war die Partei, und sei es nur als „Instrument“, schlichtweg untauglich. Indem er den Aufbau neuer proletarischer Institutionen forderte, gab auch Panzieri selbst das implizit zu. Dennoch hoffte er auf eine Erneuerung der alten Arbeiterbewegung von innen heraus und fühlte sich der PSI (welche lange Jahre seine politische Heimat gewesen war) nach wie vor verbunden.
Krise der Gewerkschaften
Das verhinderte aber nicht, dass er in der Partei mehr und mehr an den Rand gedrängt wurde. Desillusioniert siedelte Panzieri 1959 von Rom nach Turin über, wo ihm eine Stelle beim renommierten Verlagshaus Einaudi angeboten worden war. Dort fand er bald Kontakt zu anderen Abtrünnigen und Unzufriedenen, welche die Lage ähnlich sahen, wie Panzieri Ende 1959 es in einem Brief skizzierte: „Die Krise der Organisationen – Parteien wie Gewerkschaften – liegt in der wachsenden Trennung zwischen ihnen und der realen Bewegung der Klasse, zwischen den objektiven Kampfbedingungen und der Ideologie und Politik der Parteien begründet. Deswegen kann das Problem nur angegangen werden, indem man von den Bedingungen, Strukturen und Bewegungen der Basis ausgeht. Und die Analyse wird nur durch Teilnahme an den Kämpfen vollständig werden.“ (2)
An die Basis, in die Fabriken gehen, die Verhältnisse dort untersuchen, Analysen erarbeiten und sich auf diesem Wege in die laufenden Konflikte einmischen – genau das war das Aktionsprogramm der Gruppe, die sich um die Quaderni Rossi sammelte. Die Zeitschrift war in diesem Sinne nicht nur als Forum für theoretische Reflexion, sondern auch als Mittel der Intervention gedacht.
Unterstützung für das Projekt kam auch von einigen lokalen Funktionären des Gewerkschaftsbunds CGIL (3), welche über den schwindenden Rückhalt ihrer Gewerkschaft unter den Arbeiter*innen besorgt waren.
Die Unternehmen setzten auf Massenproduktion für den Export. Damit ging nicht nur eine massive Ausweitung der Fließbandarbeit einher. Zugleich geriet dadurch auch die Facharbeiterschaft, welche traditionell das Rückgrat der Gewerkschaften bildete, immer mehr unter Druck. Die Spezialkenntnisse der Facharbeiter wurden durch die zunehmend mechanisierte Produktion weitgehend verzichtbar, und damit schwand auch ihre Durchsetzungsmacht. Diese Schwächung der Gewerkschaften war von den Unternehmen auch durchaus gewünscht. So wurden z.B. kommunistische Gewerkschaftsfunktionäre in gesonderten Abteilungen von den anderen Arbeiter*innen isoliert – bekannt und berüchtigt war in dieser Hinsicht vor allem die Abteilung ‚Roter Stern’ bei Fiat. Zugleich stellten die Unternehmen massiv neue Arbeitskräfte ein. Rund eine Million neuer Beschäftigter kam so in die Produktion, gegen Ende der 1950er vor allem junge Männer aus dem Süden Italiens – eine neue Generation von Arbeiter*innen, die kaum einen Bezug zu den Institutionen der alten Arbeiterbewegung hatten.

Die Gewerkschaftsführung hatte dieses Schwinden ihrer Basis lange ignoriert. Sie mühte sich vielmehr, in der großen Politik mitzumischen, wo sie z.B. staatliche Investitionsprogramme zur Sicherung der Vollbeschäftigung forderte. Dafür bekam sie bald die Quittung: 1955 verlor die CGIL bei den Betriebsratswahlen bei Fiat ihre bis dahin unangefochtene absolute Mehrheit. Aber auch diese offensichtliche Niederlage führte nicht zu einem Umdenken. Die Gewerkschaft bemühte sich zwar um ein offensiveres Auftreten bei den Lohnverhandlungen. Damit war sie aber insgesamt wenig erfolgreich. Im Vergleich zur steigenden Arbeitsproduktivität stagnierten die Löhne. Und ohnehin war es längst nicht nur die miese Bezahlung, welche für Unmut unter den Arbeiter*innen sorgte, sondern noch ganz andere Fragen, etwa der Stumpfsinn der Fließbandarbeit oder die rigiden Zeitvorgaben.
Was für Konflikte sich da anbahnten, ließ sich 1959 schon erahnen. Denn langsam aber sicher begann sich neuer Widerstand der Arbeiter*innen zu regen. Exemplarisch dafür waren z.B. die Streiks, die 1960 in der Textilindustrie begannen. Bei diesen Kämpfen spielten die Gewerkschaften kaum eine Rolle: Nur etwa 10% der (größtenteils weiblichen) Beschäftigten waren überhaupt gewerkschaftlich organisiert. Dennoch zeigte sich in ihren Kämpfen eine Art der ‚unsichtbaren Organisation’, die sich in neuartigen Aktionsformen äußerte, etwa sogenannte „Schachbrettstreiks“, welche die Produktionskette plötzlich, stunden- oder schichtweise an immer wechselnden Abschnitten lahmlegten.
Und auch in der norditalienischen Metallindustrie kam es 1959/60 zu flächendeckenden Streiks. Diese Kämpfe waren nebenbei auch ein schlagender Gegenbeweis zu der These, durch die Neustrukturierung der Industrie sei der Klassenkampf endgültig befriedet: Denn nun traten gerade in den technisch fortschrittlichsten Unternehmen die heftigsten Konflikte zu Tage – wobei allerdings die Fiat-Werke eine bezeichnende Ausnahme bildeten. Aus genau diesem Grund war Fiat dann auch das erste Ziel der Fabrikuntersuchungen, die von den Aktivist*innen der Quaderni Rossi begonnen wurden.
In politischer Hinsicht war aber ein weiteres Ereignis von noch größerer Wichtigkeit: Anfang Juli 1960 hatte die neofaschistische Partei MSI (Movimento Sociale Italiano) ihren Nationalkongress anberaumt – mit Unterstützung der Regierung, und ausgerechnet in Genua. Nur 15 Jahre nach Kriegsende und in einer Stadt, die als traditionelle Hochburg der Arbeiterbewegung bekannt war, musste dies als klare Kampfansage erscheinen. In Genua kam es zu tagelangen Straßenschlachten zwischen der Polizei auf der einen und Student*innen und Arbeiter*innen auf der anderen Seite (4). Landesweit gab es Demonstrationen. Die Unruhen führten schließlich zum Sturz des Ministerpräsidenten Tambroni und zu einem neuen Mitte-Links-Bündnis, in dem nun auch die PSI einen Platz hatte.

Kritik der Maschinerie
Die erste Nummer der Quaderni Rossi stieß unter diesen Umständen auf reges Interesse. Die Auflage war in wenigen Tagen ausverkauft, und wurde nicht nur in der Linken gelesen und diskutiert. Panzieri veröffentlichte in diesem Heft einen Artikel „Über die kapitalistische Anwendung der Maschinerie im Spätkapitalismus“ (5), in welchem er die Grundzüge jener marxistischen Technologiekritik entwickelte, die einen der wesentlichen und originellsten Teile der operaistischen Theorie ausmacht. Vorrangig ging es Panzieri in seinem Text darum, „die verschiedenen ‚objektivistischen’ Ideologien zu widerlegen, die derzeit im Hinblick auf den technischen Fortschritt (insbesondere im Zusammenhang mit der Phase der Automation) wieder aufkommen.“
Gemeint war damit das typische Technikkonzept der sozialdemokratisch-leninistischen Linken, das sich grob in drei aufeinander aufbauenden Glaubenssätzen zusammenfassen lässt: 1. Die technischen Produktionsmittel haben mit den Produktionsverhältnissen, den gesellschaftlichen Macht- und Eigentumsverhältnissen, nicht das Geringste zu tun. 2. Die Technik entwickelt sich eigenständig, aus ihrer eigenen inneren Logik heraus. Und weil 3. die Technik in sich vernünftig ist, steht der technische Fortschritt immer auf Seiten des Fortschritts schlechthin. (6)
Mit diesem Schema ließen sich die ökonomischen Umwälzungen der Nachkriegszeit beim besten Willen nicht erfassen. Und genau in dieser Unfähigkeit sah Panzieri die anhaltende Krise der Gewerkschaften begründet. Nach wie vor, so bemerkte er, würden die Veränderungen in zahlreichen Positionen und Analysen nur verzerrt erfasst, indem sie „in ‚reiner’, idealisierter Form dargestellt werden, isoliert von den konkreten Zusammenhängen mit den allgemeinen und (in Bezug auf die Macht) entscheidenden Elementen der kapitalistischen Organisation.“ Maßnahmen und Neuerungen, die vor allem die Macht der Unternehmer sichern und zur Kontrolle der Arbeiter*innen beitragen sollten, würden so „mit Entwicklungsstufen einer objektiven ‚Rationalität’ verwechselt“.
So wurde beispielsweise „die positive, ‚rationale’ Funktion des MTM betont, da ‚der Techniker durch die Fertigungszeiten gezwungen ist, die Methoden zu untersuchen’“. (Panzieri zitierte an dieser Stelle den CGIL-Funktionär Silvio Leonardi.) MTM steht für methods-time measurement (deutsch meist als „Arbeitsablauf-Zeitanalyse“ übersetzt). Bei dieser Methode werden die für einzelne Arbeitsvorgänge benötigten Zeiten gemessen, tabellarisch erfasst und auf dieser Grundlage dann Planvorgaben für bestimmte Fertigungsschritte gemacht. Die Zielsetzung solcher Maßnahmen – die größtmögliche Verdichtung der Arbeitszeit – war eigentlich offensichtlich. Das hinderte Gewerkschaftsfunktionäre wie Silvio Leonardi aber nicht daran, in jeder derartigen Maßnahme der Unternehmer einen weiteren Schritt in Richtung Sozialismus zu sehen.
Panzieri hatte dafür nur beißenden Spott übrig: „Man hegt nicht den leisesten Verdacht, dass der Kapitalismus die neue ‚technische Basis’, die der Übergang zum Stadium der fortgeschrittenen Mechanisierung (und der Automatisierung) ermöglicht hat, dazu ausnutzen könnte, um die autoritäre Struktur der Fabrikorganisation zu verewigen und zu konsolidieren. Der ganze Industrialisierungsprozess ist nämlich angeblich von der ‚technologischen’ Zwangsläufigkeit beherrscht, die zur Befreiung ‚des Menschen von den Schranken führt, die ihm seine Umwelt und seine physischen Möglichkeiten auferlegen’.“
Panzieri dagegen betrachtete (ähnlich wie Marx) das „Maschinensystem“ der Fabrik vor allem als Herrschaftsinstrument: „Im Kapitalismus werden nicht nur die Maschinen, sondern auch die ‚Methoden’, die Organisationstechniken, usw., dem Kapital einverleibt und den Arbeitern als Kapital, als ihnen fremde ‚Rationalität’, gegenübergestellt. Die kapitalistische ‚Planung’ setzt die Planung der lebendigen Arbeit voraus“. Indem er so die Rolle der Planung für die kapitalistische Wirtschaft hervorhob, leistete Panzieri sich gleich noch einen weiteren Verstoß gegen die marxistisch-leninistische Orthodoxie, für die „Planung“ und „Sozialismus“ ein und dasselbe waren.
So widersprach er energisch allen Hoffnungen, die technische Entwicklung würde schon von allein den geschichtlichen Fortschritt mit sich führen. Es gebe „keinen ‚objektiven’, verborgenen Faktor, der dem technischen Fortschritt oder der Planung in der spätkapitalistischen Gesellschaft immanent ist und die ‚automatische’ Transformation oder den ‚notwendigen’ Umsturz der bestehenden Verhältnisse gewährleistet.“ Nur durch die Auflehnung der Arbeiter*innen könne der Kapitalismus überwunden werden, und diese Überwindung geschehe „nicht als Fortschritt, sondern als Bruch, nicht als ‚Enthüllung’ der verborgenen Rationalität, die dem modernen Produktionsprozess innewohnt, sondern als Schaffung einer vollkommen neuen Rationalität, die im Gegensatz zu der vom Kapitalismus praktizierten Rationalität steht.“

In theoretischer Hinsicht war das ein wichtiger Schritt nach vorne, auch wenn Panzieris Analyse in vielen Punkten noch reichlich holzschnittartig blieb. Die Untersuchungen in den Fabriken, wie sie die Aktivist*innen der Quaderni Rossi 1961 begannen, sollten bald ein weitaus widersprüchlicheres Bild ergeben… Aber dazu mehr im nächsten Teil.
Fussnoten Teil 1:
(1) Raniero Panzieri: „Sieben Thesen zur Frage der Arbeiterkontrolle“, Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit, Nr. 10 (1989), S. 171ff.
(2) zitiert nach Steve Wright: „Den Himmel stürmen. Eine Theoriegeschichte des Operaismus“, Assoziation A, Hamburg/Berlin 2005, S. 31.
(3) Confederazione Generale Italiana del Lavoro, während des 2. Weltkriegs mit Unterstützung der kommunistischen, sozialistischen und christdemokratischen Parteien gegründet, um 1960 aber vor allem der PCI nahe stehend.
(4) Eine lebendige Beschreibung der Ereignisse findet sich bei Danilo Montaldi: „Italien, Juli 1960“, in Nanni Ballestrini/Primo Moroni: „Die goldene Horde – Arbeiterautonomie, Jugendrevolte und bewaffneter Kampf in Italien“, Assoziation A, Berlin 2002, S. 18.
(5) Online unter www.wildcat-www.de/thekla/07/t07panzi.htm zu finden. Die oben angegebenen Seitenzahlen folgen denen der deutschen Übersetzung in Claudio Pozzoli (Hg.): „Spätkapitalismus und Klassenkampf – Eine Auswahl aus den Quaderni Rossi“, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt a. M. 1972.
(6) Diese Haltung hat in der sozialdemokratisch-bolschewistischen Linken eine lange Tradition. Symptomatisch dafür ist z.B. eine Äußerung Lenins aus dem Jahre 1918 über die Vorzüge der „wissenschaftlichen Arbeitsorganisation“. Diese vereinige in sich „die raffinierte Bestialität der bürgerlichen Ausbeutung und eine Reihe wertvollster wissenschaftlicher Errungenschaften in der Analyse der mechanischen Bewegungen bei der Arbeit, der Ausschaltung überflüssiger und ungeschickter Bewegungen, der Ausarbeitung der richtigsten Arbeitsmethoden, der Einführung der besten Systeme der Rechnungsführung und Kontrolle usw.“ zu bieten habe, und folgerte: „Die Sowjetrepublik muss um jeden Preis das Wertvolle übernehmen, was Wissenschaft und Technik auf diesem Gebiet errungen haben.“ Vergleiche dazu auch Angelika Ebbinghaus, „Taylor in Russland“,
Operaismus für Anfänger*innen (Teil 2)
Willkommen zum zweiten Teil unserer Operaismus-Reihe. Nachdem im letzten Heft vor allem die historischen Umstände behandelt wurden, unter denen sich der Operaismus als eigenständige Strömung der italienischen radikalen Linken entwickelte, soll dieser zweite Teil nun tiefer in die Materie einführen. Vor allem soll hier ein zentraler Angelpunkt der operaistischen Theorie und Praxis beleuchtet werden: das Projekt der „Arbeiteruntersuchung“. Und wir wollen uns einer Person widmen, ohne die diese Untersuchung und der Operaismus insgesamt wohl kaum zu denken wäre – Romano Alquati.
Rufen wir uns aber vorher kurz die Ausgangslage in Erinnerung: Um 1960 befand sich die traditionelle Arbeiterbewegung in Italien in einer tiefen Krise. Die großen Unternehmen – allen voran das Automobilunternehmen FIAT – hatten den Boom der Nachkriegszeit dazu genutzt, ihre Produktionsanlagen umfassend zu modernisieren. Mit der flächendeckenden Einführung der Fließbandfertigung ging auch eine weitgehende Dequalifizierung der alten Facharbeiterschaft einher, auf die sich traditionell die Macht der linken Parteien und Gewerkschaften stützte. Zugleich stellten die Unternehmen eine große Zahl an Arbeitskräften ein, die zu Anfang der 1950er Jahre noch meist aus Norditalien stammten. Gegen Ende des Jahrzehnts kamen diese jungen Arbeiter*innen aber vor allem aus dem agrarisch geprägten, verarmten Süden des Landes in die Industriestädte des Nordens. Sie waren auch die treibende Kraft hinter den neuen Konflikten in den Fabriken, die sich ab 1959 zu regen begannen.
1961 wurde in Turin die Zeitschrift Quaderni Rossi (Rote Hefte) gegründet. Die treibende Kraft war dabei Raniero Panzieri, ein langjähriges Mitglied der sozialistischen Partei PSI (mit ihm haben wir uns im letzten Heft ausführlich beschäftigt). Panzieri erkannte klarer als viele seiner Genoss*innen, dass die Institutionen der Linken weitgehend den Bezug zu den Arbeiter*innen verloren hatten. Um wirksam in die aktuellen Konflikte eingreifen zu können, hielt er vor allem eine eingehende Untersuchung der Verhältnisse in den Fabriken für nötig.
Die Arbeiteruntersuchung
Die Durchführung einer solchen Untersuchung war das gemeinsame Ziel, das die Redaktion der Quaderni Rossi verband. Freilich vertraten die Aktivist*innen dabei durchaus widersprüchliche Vorstellungen und Konzepte. So wollte z.B. ein Teil der Redaktion vor allem „neutrale Wissenschaft“ nach dem Vorbild der amerikanischen Industriesoziologie betreiben. Ein anderer hatte es vor allem darauf abgesehen, die Politik der PCI (der kommunistischen Partei) zu beeinflussen und in eine kämpferischere Richtung zu lenken. Und die Turiner Mitglieder der Metallgewerkschaft FIOM, welche das Projekt anfänglich unterstützten, suchten ihrerseits vor allem einen Ausweg aus der Sackgasse, in die die Gewerkschaftspolitik geraten war.
Panzieri versuchte zwischen diesen widerstreitenden Interessen so gut wie möglich zu vermitteln. Seine eigene Konzeption der Untersuchung war eher orthodox und ging von einem recht statischen Verhältnis von Klasse und politischer „Avantgarde“ aus – auf der einen Seite sollte die Untersuchung das Klassenbewusstsein der Arbeiter*innen fördern und zugleich Informationen liefern, auf die sich die weitere politische Arbeit stützen könnte (1).
Das Konzept der conricerca, wie Romano Alquati es später entwickelte, griff da schon beträchtlich weiter aus. Schon im Begriff selbst – conricerca lässt sich wörtlich etwa als „Mituntersuchung“ übersetzen – steckt bereits eine Kritik der gängigen Industriesoziologie. Die Untersuchung, wie Alquati sie sich vorstellte, sollte keineswegs auf bloße Wissenschaft hinauslaufen. Die Arbeiter*innen sollten nicht als Forschungsobjekt angegangen, sondern vielmehr selbst zu Akteuren der Untersuchung werden. Zugleich sollte in der Untersuchung die Trennung von Theorie und Praxis, von Analyse und politischer Aktion überwunden werden. Die Theorie wurde selbst als dynamischer Bestandteil der angepeilten umstürzlerischen Praxis begriffen, wie Alquati betonte: „Wir erarbeiten unsere Hypothesen für Avantgarden, die den Kämpfen eine Richtung zu geben vermögen; nicht also für neue geschlossene und in ihrer ideologischen Reinheit isolierte ‚Gruppen’, sondern gerade für diejenigen, die mit oder ohne Titel und Mitgliedsausweis•innerhalb oder außerhalb der Fabrik […] tatsächlich im Zentrum des Klassenkampfes stehen“. (2)
Die Vorgehensweise beschrieb Alquati an anderer Stelle so: „Man beginnt damit, sich anzuschauen, wie die Fabriken beschaffen sind, wie sie wirklich funktionieren, wie die Arbeiter sind, wie die Leitung ist. Man fängt an, den Begriff der Arbeiteruntersuchung zu verbreiten, die zusammen mit den Arbeitern von ihrem subjektiven Standpunkt aus gemacht wird. Eine auf Erkenntnis und Praxis zielende Untersuchung und Forschung, die darauf gerichtet ist, Kämpfe von unten und außerhalb oder oft gegen die vermittelnde Funktion der Parteien und Gewerkschaften auszulösen“ (3)
Prägend für Alquatis Konzept waren vor allem die Erfahrungen, die er in den 1950er Jahren in Cremona und dem dortigen Milieu der undogmatischen Linken gesammelt hatte. Alquati gehörte dort der Gruppe der so genannten „Barfuß-Forscher“ an, die sich um den unorthodoxen Kommunisten und Soziologen Danilo Montaldi sammelte. In vielerlei Hinsicht nahm Montaldi wichtige Aspekte der späteren „Arbeiteruntersuchung“ vorweg. Im Zentrum seines Interesses stand das Alltagsleben von marginalisierten Gruppen, etwa der armen Landbevölkerung, das er mit den Mitteln der oral history erforschte. Ebenso wichtig war seine Tätigkeit als Übersetzer. So übertrug er etwa die Schriften der amerikanischen Correspondence-Gruppe und der französischen Socialisme ou Barbarie ins Italienische – diese Gruppen hatten schon in den 50er Jahren Untersuchungen in den Fabriken durchgeführt. Sie boten damit ein direktes Vorbild für die italienischen Aktivist*innen, die Mitte 1960 mit einer ersten Untersuchung bei FIAT begannen.
Die „neuen Kräfte“
Ein erstes Ergebnis dieser Untersuchungen war der Bericht über „Die ‚neuen Kräfte’ bei FIAT“. Alquati trug diesen zunächst im Januar 1961 bei einem Kongress der PSI vor. Wenig später wurde der Text in der ersten Ausgabe der Quaderni Rossi abgedruckt. Der Bericht beruhte vor allem auf Interviews mit Arbeiter*innen und Mitgliedern der Gewerkschaft – von einer besonders „operaistischen“ Untersuchungsmethode konnte dabei also noch nicht die Rede sein. Auch in seiner Analyse blieb der Text weitgehend an der Oberfläche, Alquati beschränkte sich auf die Beschreibung und die Wiedergabe dessen, was ihm seine Interviewpartner berichteten. Über diese Unzulänglichkeiten war sich auch Alquati im Klaren. So qualifizierte er den Text im Nachhinein (in einem Brief vom September 1971) als Ergebnis „einer persönlichen journalistischen Untersuchung“. (4)
Dennoch regte der Bericht große Debatten an. Ganz nebenbei zerlegte Alquati mit seinem Bericht einen zentralen Glaubenssatz der alten Arbeiterbewegung – die Überzeugung, dass es einen notwendigen Zusammenhang von „Klassenbewusstsein“ und „Organisation“ gebe –, indem er nachwies, dass gerade die jungen, weder gewerkschaftlich noch parteilich organisierten Arbeiter*innen es waren, welche die neuen Klassenkämpfe in der Fabrik vorantrieben.
Ab 1949 hatte bei FIAT eine Phase der „Rationalisierung“ begonnen. Insbesondere durch die Einführung neuer „Spezialmaschinen“, die keine oder nur sehr kurze Einarbeitungszeiten brauchten, trieb die Unternehmensleitung eine groß angelegte Neuzusammensetzung der Arbeiterschaft voran. Die spezialisierten Facharbeiter wurden innerhalb des Werks in andere Abteilungen versetzt bzw. entlassen und durch junge und meist ungelernte Arbeitskräfte ersetzt. Dies ging weitgehend problemlos, da sich FIAT durch vergleichsweise hohe Löhne und in Aussicht gestellte Karrieremöglichkeiten ein neues Image als „Arbeiterparadies“ schaffen konnte.
Die vermeintlichen Aufstiegschancen erwiesen sich jedoch bald als Illusion. Die Löhne stagnierten auf lange Sicht. Die Beschäftigten an den Montagebändern und die jungen Techniker erkannten bald, dass die von FIAT angebotenen „Qualifikationen“ wertlos waren und keineswegs zum Aufstieg in eine höhere Lohngruppe führten oder eine erfüllendere Tätigkeit mit sich brachten.
Die jungen Arbeiter*innen hatten von vornherein wenig Bezug zu den linken Parteien und Gewerkschaften, und da deren Politik kaum einen Bezug zu ihren Alltagsproblemen hatte, blieb diese Distanz bestehen. Alquati schrieb: „Wir können heute beobachten, dass die jungen Arbeiter zwar die Richtigkeit der Gewerkschaftsforderungen anerkennen, dass aber dann selbst diejenigen von ihnen, die in der Fabrik am engagiertesten für eine Wiederaufnahme der Arbeiterkämpfe arbeiten, sich regelmäßig nicht etwa nur weigern, in die Gewerkschaft einzutreten […], sondern sich vor allem weigern, in irgendeiner Form organisatorische Verantwortung dafür zu übernehmen, dass die Organisation, die diese Forderung erhebt, tatsächlich Fuß fasst.“ Auch die Passivität der älteren Arbeitergeneration, bei der sich nach jahrelangen Rückschlägen und Niederlagen kaum noch Widerstand regte, wirkte abschreckend auf die jungen Arbeiter*innen und verstärkte deren ablehnende Haltung gegenüber den Gewerkschaften: „Die jungen Arbeiter glauben nicht an die vorhandenen Mittel zur Durchsetzung der Forderungen, denn sie erkennen darin jene Mittel wieder, die zur Integration der alten Arbeiter geführt hatten.“
Die Gewerkschaften waren unfähig, sich aus sich selbst heraus zu erneuern. Jene ihrer Mitglieder, die sich ernsthaft um Kontakt zu den „neuen Kräften“ bemühten, steckten damit in einem Dilemma – „auf der einen Seite ist eine Erneuerung notwendig, um die jungen Arbeiter anzuziehen, auf der anderen Seite ist eine Erneuerung nur möglich, wenn die jungen Arbeiter selbst kommen und die Organisation erneuern.“
Untersuchung bei OLIVETTI
Während der Bericht über FIAT auf einem „journalistischen“ Alleingang Alquatis beruhte, ergab sich wenige Monate später die Möglichkeit, eine wirkliche kollektive Untersuchung durchzuführen. Ort des Geschehens war das Werk des Unternehmens OLIVETTI (die Firma produzierte vor allem Rechen- und Schreibmaschinen) in Ivrea, einer etwa 70 Kilometer nordöstlich von Turin gelegenen Stadt.

Alquati selbst beschrieb den zeitlichen Ablauf der Untersuchung bei OLIVETTI so: „Es waren zunächst zwei Genossen, die mit dieser Arbeit begonnen haben, dann arbeiteten hier etwas mehr als zehn Kader mit“ – bei den letzteren handelte es sich um Kader der örtlichen PSI, die die Untersuchung unterstützten. Im Sommer 1961 wurden „über hundert Gespräche geführt. Damit war das erste Ziel erreicht: nämlich die Suche nach anderen, nichtorganisierten jungen Arbeitern und die Beteiligung einiger ganz junger Arbeiter, die bisher noch nicht politisch gearbeitet hatten; diese Arbeiter konnten jetzt selbständig die Arbeit weiterführen“
Die Beschreibung stammt aus einem Text Alquatis über „Organische Zusammensetzung des Kapitals und Arbeitskraft bei OLIVETTI“, der in zwei Teilen in der Quaderni Rossi Nr. 2 und 3 abgedruckt wurde und die Ergebnisse der Untersuchung zusammenfasste. Dieses Dokument bietet ein gutes Beispiel der Konzepte und Begrifflichkeiten, die die Aktivist*innen entwickelten, um die komplizierten Verhältnisse und Konflikte in der Fabrik zu erfassen. Freilich würde es hier den Rahmen sprengen, diesen etwa 70 Seiten langen, oft recht kryptischen Text der Reihe nach durchzugehen. Ich werde im Folgenden lediglich einige zentrale Punkte erläutern.
Die Streiks der Jahre 1960 und 1961 waren zwar ein hoffnungsvolles Zeichen gewesen, hatten dabei die jungen Arbeiter*innen doch erstmals unabhängig die Initiative ergriffen. Aber zugleich waren diese Kämpfe beschränkt geblieben und gerade die Arbeite*innen der größten Werke hatten sich kaum daran beteiligt.
Welche Möglichkeiten gab es nun, diese Isolation zu überwinden? Um das zu beurteilen, war es notwendig, den Produktionsprozess im Ganzen zu untersuchen, die Verbindungen zwischen den Arbeiter*innen und ihren Tätigkeiten ebenso in den Blick zu nehmen wie die bestehenden Hindernisse und Spaltungslinien.
Alquati ging davon aus, dass sich die sozialen Kämpfe keineswegs „spontan“ ergaben, sondern auf einer informellen, „unsichtbaren“ Organisation der Arbeiter*innen beruhten. Anzeichen dafür hatte er schon bei FIAT vorgefunden, und von dieser Ausgangsthese wurde auch die Untersuchung bei OLIVETTI gelenkt.
Von zentraler Bedeutung ist hier der Begriff der Kooperation. Anders gesagt: Im Produktionsprozess selbst sind die Arbeiter*innen bereits organisiert, nämlich durch das Kapital. Einerseits wird jede/r Arbeiter*in eine eng begrenzte Teilaufgabe im Gesamtprozess zugewiesen, zugleich aber müssen die Arbeiter*innen und ihre vereinzelten Tätigkeiten notwendig in Bezug zueinander treten, damit im Produktionsprozess tatsächlich ein verwertbares Produkt entsteht. Das Kapital kann nicht auf diese Kooperation der Arbeiter*innen untereinander verzichten. Diese ist ihrem Wesen nach ambivalent, einerseits eine Produktivkraft im Dienst des Kapitals, zugleich aber auch die Grundlage eines möglichen Widerstands.
Organisation, Plan und Kooperation
An diesem Punkt knüpfte Alquati an die Technologiekritik an, wie sie zunächst von Raniero Panzieri formuliert worden war (vgl. Teil 1 unserer Artikelreihe). Er zeichnete allerdings ein widersprüchlicheres Bild, indem er die Entwicklung der Maschinerie mit dem Verhalten der Arbeiter*innen in Beziehung setzte.
Mittels der Maschinerie war es der Unternehmensleitung möglich, auf die Kooperation der Arbeiter*innen Einfluss zu nehmen – bestimmte „Sachzwänge“ zu schaffen, Zeiten für bestimmte Arbeitsschritte vorzugeben und damit Druck auszuüben usw. Vor allem das Fließband spielte eine wichtige Rolle dabei, die verschiedenen Tätigkeiten „dem Niveau der kürzesten Arbeitszeit anzugleichen“. Diese Kontrolle, wie sie in der Maschinerie selbst schon angelegt war, wurde durch die Methoden der „wissenschaftlichen Arbeitsorganisation“ (Analyse der Bewegungsabläufe, Zeitmessungen usw.) ergänzt.
Das ideale Ziel der Unternehmensleitung war ein Endzustand, in dem die Kooperation der Arbeiter*innen völlig über die Maschinerie vermittelt und von dieser bestimmt gewesen wäre – ein Zustand umfassender Kontrolle, in dem die von oben kommenden Befehle umstandslos erfüllt wurden und das Management stets genau informiert war, was an jedem Teilabschnitt vor sich ging.
Dieses Ideal ließ sich freilich nicht realisieren. So lief die technische Entwicklung nicht einfach auf eine stetig wachsende „Dequalifizierung“ oder eine immer stärkere Unterwerfung der Arbeiter*innen unter die Maschinerie hinaus. Zwar wurden diesen in der Tat bestimmte Entscheidungskompetenzen genommen. Dieser Prozess lief aber keineswegs darauf hinaus, die Arbeiter*innen insgesamt auf den Stand von „Affen“ oder „Automaten“ zu reduzieren, wie es die gängige linke Kritik befürchtete. Letztlich wurden gerade die gleichförmigen Routinebewegungen auf die Maschinerie übertragen, während die Arbeiter*innen vor allem jene Aufgaben übernehmen mussten, die bewusste Aufmerksamkeit verlangten. Tatsächlich waren auch die „unqualifizierten“ Arbeitskräfte am Fließband ständig zur Improvisation und zur schnellen Entscheidungsfindung gezwungen, übten also keineswegs nur eine rein „ausführende“ Tätigkeit aus (5).
Das war natürlich nicht unbedingt eine Verbesserung: Die körperliche Anstrengung wurde durch die Technik verringert, aber dafür kamen neue, vor allem nervliche Belastungen hinzu, die auf Dauer ebenso zermürbend waren – zumal die Arbeitszeit stetig verdichtet und den Beschäftigten immer noch zusätzliche Aufgaben aufgebürdet wurden.
Zugleich machte Alquati bei seinen Gesprächen regelmäßig die Erfahrung, „dass die Arbeiter, die zunächst die gesamten konventionellen, offiziellen Mythen über die Organisation der Abteilung wiederholt hatten, am Ende schließlich so darüber urteilen: ‚Hier ist alles bis ins kleinste organisiert und festgelegt, und trotzdem gibt es noch zu viele wichtige Dinge, die bei der Arbeit nicht funktionieren. Wenn man sieht, wie minutiös man sich hier um eine Organisation kümmert, die dann doch nicht so funktionieren kann, dann könnte man fast auf den Gedanken kommen, dass bei OLIVETTI die organisierte Desorganisation studiert wird.’“
Unter diesen Umständen konnten die Arbeiter*innen viele vorgegebene Planziele nur in eigenmächtiger Weise erreichen, indem sie die Arbeit neu unter sich verteilten, Vorschriften bewusst ignorierten usw. Die Planziele wurden erfüllt, aber ihre Umsetzung erfolgte in einer Weise, „die für die Betriebsspitze nicht zu erkennen ist“ – „der Kapitalist ist so gezwungen, immer wieder von vorne anzufangen und sich der Art anzupassen, wie der Arbeiter seinen Plan verwirklicht. Hier verbirgt sich in den Arbeitsverhältnissen eine tägliche Klassenauseinandersetzung“, wie Alquati erkannte.
Dieser Konflikt äußerte sich vor allem als zäher Kleinkrieg: Die Arbeiter*innen versuchten sich die Arbeit zu erleichtern, ein paar freie Minuten zu gewinnen, während Management, Kontrolleure usw. ihrerseits versuchten, diese Lücken zu schließen und die Arbeitszeit so weit wie möglich zu verdichten.
Alquati beschrieb dies als Kreisbewegung mit folgenden Stationen: Zunächst wird eine neue Maschine eingeführt, was mit der Festsetzung einer vorläufigen neuen Arbeitsnorm einhergeht. Diese kann von den Arbeiter*innen zunächst nur in improvisierter, informeller Weise bewältigt werden. Nach und nach bilden sich dabei neue Handlungsroutinen und Fertigkeiten heraus, die dann wiederum als Ausgangsbasis für neue Planvorgaben dienen.
Die informelle Kooperation der Arbeiter*innen bildete so die Grundlage der technischen Erneuerung und Modernisierung. Zugleich erkannte Alquati in diesen Verhaltensweisen die ersten Ansätze einer möglichen „Arbeiterautonomie“ gegenüber dem Kapital. Die weitere technische Vereinheitlichung der Produktionsabläufe, so lautete seine These, würde mittelfristig auch zu einer Neuzusammensetzung der Arbeiter*innenklasse und zu einer Ausweitung der bestehenden Konflikte innerhalb der Fabriken führen.
Es sollte sich rasch zeigen, dass Alquati mit dieser Prognose richtig lag. Im Sommer 1962 machte eine Welle von Streiks deutlich, wie groß die Entfremdung zwischen der Arbeiterschaft und der institutionellen Arbeiterbewegung inzwischen geworden war. Indem sie sich in diese Konflikte einmischten, gerieten die operaistischen Aktivist*innen rasch in Konfrontation mit der Gewerkschafts- und Parteibürokratie. Zugleich traten auch innerhalb der Redaktion der Quaderni Rossi die politischen Gegensätze offen zutage – eine Spaltung wurde unvermeidlich. Im selben Maße, wie die neuen autonomen Klassenkämpfe an Fahrt gewannen, gewann auch die operaistische Theorie an Eigenständigkeit und nahm genauere Konturen an. Aber dazu mehr im nächsten Heft.
Fussnoten Teil 2:
(1) So liest es sich jedenfalls in Panzieris Text über den „Sozialistischen Gebrauch des Arbeiterfragebogens“, in „Spätkapitalismus und Klassenkampf – Eine Auswahl aus den ‚Quaderni Rossi’“, Europäische Verlagsanstalt, Frankfurt a.M. 1972, S. 105ff. Online ist der Text unter eipcp.net/transversal/0406/panzieri/de zu finden.
(2) Der Text „Organische Zusammensetzung des Kapitals und Arbeitskraft bei OLIVETTI“ ist als PDF unter www.wildcat-www.de/thekla/05/t05_oliv.pdf zu finden.
(3) Zitat nach Nanni Ballestrini/Primo Moroni: „Die goldene Horde – Arbeiterautonomie, Jugendrevolte und bewaffneter Kampf in Italien“, Assoziation A, Berlin 2002
(4) Zitiert nach Rieland/Alquati 1974, S. 29.
(5) Schon in seiner Untersuchung zu FIAT hatte Alquati bemerkt, dass die Qualifizierung nur dazu diente, „die Existenz hierarchischer Stufen zu verfestigen und unter den Arbeitern durchzusetzen, indem man diese Stufen mit einem ‚falschen’ Prestige ausstattet, dessen ‚Absurdität’ den neuen Arbeitern durchaus nicht entgeht. […] Das ganze System der Hierarchisierung hat sowohl innerhalb als auch außerhalb der Fabrik eine politische Funktion.“ Siehe Rieland/Alquati 1974, S. 77.
Operaismus für Anfänger*innen (Teil 3)
Bevor wir in den dritten Teil unserer Operaismus-Reihe einsteigen, ist es wohl sinnvoll, noch einmal einen Blick zurückzuwerfen, auf das, was bisher geschah: 1961 gründete sich in Turin die Zeitschrift Quaderni Rossi. Die Initiative dazu ging von Raniero Panzieri aus, der zuvor lange Zeit in der sozialistischen Partei Italiens (der PSI) aktiv gewesen war. Seiner Einschätzung nach hatten sich die Gewerkschaften und die linken Parteien, die PSI ebenso wie die kommunistische PCI, gründlich von ihrer proletarischen Mitgliederbasis entfremdet. Die rasante Modernisierung der norditalienischen Industrie hatte neue Probleme und Konfliktfelder geschaffen, aber die Organisationen der Arbeiterbewegung wussten darauf nicht zu reagieren.
Die Gruppe aus dem Umfeld der Quaderni Rossi setzte es sich dagegen zum Ziel, die Verhältnisse in den Fabriken zu erforschen. Wichtig war dabei vor allem die Initiative von Romano Alquati, mit der ich mich im letzten Heft beschäftigt habe. Für Alquati sollten die Arbeiter*innen nicht passive Objekte der Untersuchung sein, sondern diese selbst vorantreiben. Dieser Plan konnte nur bedingt umgesetzt werden, aber immerhin gewann man bei FIAT und OLIVETTI wichtige Einsichten in das Innenleben der Fabriken. Gerade unter den jungen Arbeiter*innen war die Unzufriedenheit allgemein verbreitet – und Alquati meinte, dass gerade diese „neuen Kräfte“ in den Klassenkonflikten, die sich bereits am Horizont abzeichneten, eine zentrale Rolle spielen würden.
Aufstand auf der Piazza Statuto
Der Wendepunkt kam schneller als vermutet. Das Jahr 1962 markierte den Übergang von der Ära des „Wiederaufbaus“ und der relativen Ruhe der 50er Jahre zu einem neuen Zyklus der Klassenkämpfe. In vielen Unternehmen standen neue Tarifverhandlungen an. Bei diesem Anlass entlud sich der Unmut, der sich schon lange angestaut hatte. Zentrum der Unruhe war Turin, wo auch die Redaktion der Quaderni Rossi ihren Sitz hatte.
Schon Anfang des Jahres traten die Arbeiter*innen bei Lancia und Michelin in den Streik. Bald schlossen sich die Belegschaften der anderen Metallbetriebe an. Und anders als in den Jahren zuvor wurde diesmal auch in den FIAT-Fabriken – Gießerei, Flugzeugwerk, Luftfahrttechnik und Walzwerk – die Arbeit niedergelegt. Auf dem Höhepunkt waren in Turin 250.000 Arbeiter*innen im Streik.
Die Unternehmensführung von FIAT bemühte sich, die Lage unter Kontrolle zu bringen. Sie schloss nicht nur mit der ‚gelben’ (also von der Unternehmerseite selbst aufgebauten) Gewerkschaft SIDA eine separate Vereinbarung ab. Auch die sozialistische Gewerkschaft UIL (Unione Italiana del Lavoro) war zu gesonderten Verhandlungen bereit. Der Vertrag, auf den sie sich schließlich mit dem Management einigte, beinhaltete zwar Zugeständnisse beim Lohn, aber wesentlich wichtigere Fragen z.B. der Arbeitsorganisation wurden darin gar nicht berührt.
Es gelang freilich nicht, mit diesem Schachzug die Streikenden zu spalten und den „Frieden“ wieder herzustellen. Eher im Gegenteil: Am 7. Juli wurde nicht nur wie geplant gestreikt und die ganze Stadt lahmgelegt. Am frühen Nachmittag sammelte sich außerdem eine Menge von aufgebrachten Arbeiter*innen vor dem Sitz der UIL auf der Piazza Statuto. Die Zahl der Protestierenden (viele von ihnen waren selbst Mitglieder der Gewerkschaft) wuchs rasch, bald belagerten Tausende die UIL-Zentrale. Es kam zu Auseinandersetzungen mit der Polizei, die sich rasch zu Straßenschlachten auswuchsen und drei Tage andauerten.
Die „scontri di Piazza Statuto“ (Zusammenstöße auf der Piazza Statuto) waren in mehrfacher Hinsicht bedeutend. Nicht nur trat hier deutlich zu Tage, wie sehr die wechselseitige Entfremdung zwischen den Arbeiter*innen und den sie vertretenden Organisationen mittlerweile gediehen war. Zugleich betrat hier zum ersten Mal unübersehbar die Figur des „Massenarbeiters“, die bald eine zentrale Rolle in der operaistischen Debatte einnehmen sollte, die politische Bühne.
Schon Romano Alquati hatte in seinen Untersuchungen bei OLIVETTI und FIAT die Rolle der jungen, gering qualifizierten Arbeiter*innen erkannt und beschrieben. Diese „Massenarbeiter“ zeigte sehr spezifische Merkmale: Sie waren typischerweise männlich (FIAT begann erst ab 1970 verstärkt Frauen einzustellen), zwischen 20 und 30 Jahre alt, und stammten zumeist aus dem verarmten, agrarisch geprägten Süden Italiens. Die Fabrik war für sie zunächst ein fremdes Terrain. Sie hatten wenig Bezug zur Kultur der älteren Arbeitergeneration, die oft noch von der Erfahrung der Resistenza, des antifaschistischen Widerstands, geprägt war, und standen den Gewerkschaften und linken Parteien distanziert gegenüber. Und die stupide, monotone Arbeit am Fließband bot ihnen kaum Gelegenheit, sich einen „Berufsstolz“ zuzulegen, wie er bei den älteren Facharbeitern noch verbreitet war. Daraus ergaben sich auch andere politische Perspektiven. Eine Selbstverwaltung, also die eigenverantwortliche Übernahme der Produktion konnte für die jungen Arbeiterinnen nicht das erste Ziel sein – wenn sie politisch aktiv wurden, dann aus dem klaren Bewusstsein heraus, dass sie diese Produktion ganz sicher nicht weiterführen wollten. Das schlug sich auch in ihren Aktionsformen nieder, z.B. in Sabotageakten, bei denen auch die Zerstörung der Maschinerie in Kauf genommen wurde.
Die Spaltung
Die neuartige Qualität der Ereignisse brachte auch die Redaktion der Quaderni Rossi in schwere innere Konflikte. Während sie die Streiks sehr gründlich analysierten, äußerten sie sich zu „den Ereignissen auf der Piazza Statuto“ nur sehr zurückhaltend.
Einzelne Funktionäre der Turiner CGIL (des kommunistischen Gewerkschaftsverbandes) und der Metallgewerkschaft FIOM hatten die Intervention zwar zunächst unterstützt. Und schon im August 1961 war es gelungen, einen Streik in den FIAT-Eisenhütten zu organisieren, der sehr dazu beitrug, den Rückhalt der FIOM unter den Arbeiter*innen zu verstärken – bei den nachfolgenden Wahlen zur Betriebskommission schnitt die Gewerkschaft jedenfalls deutlich besser ab. Danach wurden die Gewerkschafter*innen jedoch von der PCI (der kommunistischen Partei) unter Druck gesetzt und brachen die Kooperation mit den Quaderni Rossi ab.
Raniero Panzieri versuchte in dieser verfahrenen Lage zu vermitteln. Er hoffte bis zuletzt darauf, eine Erneuerung innerhalb der alten Arbeiterbewegung zu erreichen und konnte sich nicht dazu durchringen, mit den linken Parteien und Gewerkschaften zu brechen.
Aber auf lange Sicht ließ sich die Konfrontation nicht vermeiden. Die Aktivist*innen aus dem Umfeld der Zeitung waren zwar nur eine kleine und politisch weitgehend machtlose Gruppe. Aber indem sie sich auf das Terrain der Fabrik begaben, brachten sie zugleich die eingefahrene Arbeitsteilung zwischen Gewerkschaften und Partei, die säuberliche Trennung von „Ökonomie“ und „Politik“ durcheinander. Das mochte noch angehen, solange sie sich „nur“ auf die Untersuchung beschränkten. Aber sobald die Einmischung eine offen politische Form annahm, konnte dies – gerade in einer so angespannten Lage – nicht mehr hingenommen werden. Als einige Aktivist*innen im Frühjahr 1962 während des Lancia-Streiks Flugblätter vor den Fabriktoren verteilten, führte das bereits zum offenen Konflikt mit der Gewerkschaft.
In der Folge wurden die beteiligten Mitglieder der PCI aus der Partei ausgeschlossen (1). Zugleich zerlegte sich die Redaktion der Quaderni Rossi in ihre Bestandteile. Die Spaltungslinie verlief zwischen jenem Teil der Redaktion, der sich am Vorbild der amerikanischen Industriesoziologie orientierte und wenig politische Ambitionen hatte, und denen, die an die neuen Kämpfe der Arbeiter*innen anknüpfen und eine revolutionäre Politik machen wollten. Panzieri schlug sich letztlich auf die Seite der „Wissenschaftler“, während die anderen die Redaktion verließen – sie gründeten die Zeitschrift Classe Operaia („Arbeiterklasse“), deren erste Ausgabe Ende 1963 erschien. Auch Romano Alquati schloss sich dieser Fraktion an, da er mit dieser das Ziel teilte, politisch zu intervenieren – der vermeintlichen „Neutralität“ der Industriesoziologie stand er dagegen skeptisch gegenüber (2).
Die Quaderni Rossi erschienen zwar noch bis 1968, aber nach dem plötzlichen Tod Panzieris (er starb 1964 überraschend an einer Hirnembolie) war das Konzept praktisch erledigt. Nennenswerte revolutionäre Impulse gingen von der Zeitung jedenfalls nicht mehr aus.
Eine neue Arbeiterzeitung?
Classe Operaia dagegen sollte nun „eine neue Form der Arbeiterzeitung“ darstellen – so schrieb Mario Tronti in seinem Artikel „Lenin in England“, der in der ersten Ausgabe erschien (3) und als eine Art Gründungsmanifest aufgefasst werden kann. Der Titel des Textes deutete schon an, was Tronti vorschwebte: Einerseits eine Rückkehr zu den Ursprüngen der Arbeiterbewegung und des Marxismus (England), um von da aus eine entschiedene revolutionäre Politik zu betreiben – dafür stand der Name Lenins, mit dem Tronti sich offenbar identifizierte.

Tronti hatte seine ersten politischen Erfahrungen in Rom, in der Jugendorganisation der PCI gesammelt und war 1961 mit seiner Gruppe zur Redaktion der QR gestoßen. Schon in seinem Artikel „Fabrik und Gesellschaft“, der in der zweiten Ausgabe der Quaderni Rossi erschien (4), fiel er als scharfsinniger Marx-Interpret auf. Tronti spielte eine wichtige Rolle dabei, den Operaismus in eine ausformulierte Theorie zu überführen. Das war sein unbestrittenes Talent, aber (wie sich zeigen wird) auch seine Schwäche: Denn was als empirischer Befund durchaus richtig war, wurde leicht zu Unsinn, wenn man darauf eine große Geschichtsphilosophie aufbauen wollte.
Dies galt etwa für die Feststellung Panzieris, dass die Einführung des Fließbands nicht nur die Produktivität steigerte, sondern den Unternehmern auch dazu diente, bestimmte widerständige Verhaltensweisen der Arbeiter*innen zu kontrollieren. Tronti zog daraus eine kühne, aber keineswegs zwingende Schlussfolgerung: Das Proletariat geht dem Kapitalverhältnis voraus, es sitzt dem Kapital gegenüber also immer schon am längeren Hebel.
In „Lenin in England“ formulierte er dies so: „Auch wir haben erst die kapitalistische Entwicklung gesehen und dann die Arbeiterkämpfe. Das ist ein Irrtum. Man muss das Problem umdrehen, das Vorzeichen ändern, wieder vom Prinzip ausgehen: und das Prinzip ist der proletarische Klassenkampf.“ Laut Tronti war also „die kapitalistische Entwicklung den Arbeiterkämpfen nachgeordnet, sie kommt nach ihnen“. (5) Das Proletariat treibt die kapitalistische Entwicklung voran, die letztlich unumgänglich in der Revolution enden muss.
Das klang als These erstmal ziemlich schmissig und originell. Dennoch führte Trontis Forderung nach einer „neuen marxistischen Praxis“ ihn umgehend zur einem altbekannten Modell zurück: zur „Arbeiterpartei“ (mit Betonung auf „Partei“). Ähnliches ließ sich über die gesuchte „neue Form der Arbeiterzeitung“ sagen. Was Tronti vorschwebte, war „eine Zeitung, die nicht unmittelbar alle partikularen Erfahrungen wiederholt und aufnimmt, sondern sie in einem allgemein politischen Diskurs fokussiert. Die Zeitung ist in diesem Sinne ein Kontrollpunkt“… Dabei müsse das gängige Verfahren entschieden umgestülpt werden. Denn: „Der politische Diskurs überprüft die Korrektheit der partikularen Erfahrung und nicht umgekehrt. Denn der politische Diskurs ist der umfassende Klassenstandpunkt und daher die wirkliche materielle Gegebenheit.“ (6)
Schon hier zeigte sich die fatale Neigung Trontis, alle Schwierigkeiten und offenen Fragen durch Rhetorik zu überspielen. Die zuletzt zitierte Aussage war jedenfalls kaum mehr als die großspurige Ankündigung, man werde sich künftig durch die Fakten nicht mehr irritieren lassen: Wenn der „politische Diskurs“ der Theoretiker die „wirkliche materielle Gegebenheit“ darstellt, dann kann die Theorie natürlich nur recht behalten – wenn die Tatsachen ihr widersprechen, sind sie eben nicht korrekt.
Auch in politischer Hinsicht ließ das nichts Gutes erahnen: Letztlich war es eben Aufgabe der Intellektuellen, die „Parteilinie“ festzulegen, an der sich die Erfahrungen und Interessen der Arbeiter*innen zu bemessen hatten. Wenige Sätze weiter distanzierte Tronti sich zwar vom leninistischen Modell der Avantgarde-Partei. Freilich nur, weil er davon ausging, dass die benötigte politische Organisation bereits bestehe und schon entdeckt sei – in der „kompakten sozialen Masse“ der Arbeiterklasse. Antonio Negri formulierte das wenig später noch etwas schmissiger: „Heutzutage ist die ganze kämpfende Arbeiterklasse die Avantgarde.“ (7) Den Kleinkram und die mühsame Aufbauarbeit konnte man sich da natürlich sparen…
Von der Klasse … zurück zur Partei
Ohnehin lagen Rationalität und Irrationalität auf den Seiten von Classe Operaia dicht beieinander. Das wird deutlich, wenn man zum Vergleich Romano Alquatis Artikel über den „Kampf bei FIAT“ heranzieht, der ebenfalls in der ersten Ausgabe der Zeitung erschien (8). Alquati analysierte darin die wilden Streiks, zu denen es Mitte Oktober 1962 in den FIAT-Walzwerken gekommen war. Dabei verwarf er zunächst einmal entschieden die Vorstellung, dass Arbeiter*innen nicht organisiert seien, nur weil sie keiner Organisation angehörten oder den bestehenden Organisationen distanziert gegenüberstanden. Er betonte: „Der ‚Wildkatzen’-Streik ist keine anarchoide Protestform von Arbeitern, die unfähig sind, in kollektiver und organisierter Form zu kämpfen; im Gegenteil: Er erfordert ein hohes Niveau an Organisation und Zusammenhalt“. Der wilde Streik sei gerade deshalb so bedeutsam, weil er gezeigt habe, dass „sich bei FIAT eine Arbeiterorganisation entwickelt, die stark genug ist, einen solchen Streik durchzuführen – absolut außerhalb der historischen, offiziellen Organisationen.“
Daran schloss Alquati nahtlos eine Kritik der gängigen Avantgarde-Konzepte an: „Der ‚Wildkatzen’-Streik bei FIAT eliminierte die alte Idee, nach der der Arbeiterkampf auf dieser Ebene von einem besonderen internen ‚Kern’ organisiert wird, der das Monopol über das antagonistische Arbeiterbewusstsein hat. Der Streik vom 15./16. Oktober ist direkt von der ganzen und kompakten ‚gesellschaftlichen Masse’ der Arbeiter der Werke, die daran teilgenommen haben, organisiert worden.“
Alquati verwendete hier exakt die gleichen Worte wie Tronti, beide sprachen von den Arbeiter*innen als „kompakter sozialer Masse“ („compatta massa sociale“). Alquati meinte damit aber etwas durchaus Anderes – nämlich zunächst einmal nur, dass die Aktionen nicht bestimmten Personen oder Gruppen zugerechnet werden konnten. Und während Tronti bei der Rede von der „kompakten Masse“ wohl vor allem an Geschlossenheit und Kampfkraft dachte, verwies sie bei Alquati vor allem auf die Schwierigkeiten der Analyse: Die Masse war eben auch ziemlich undurchsichtig, und es ließ sich kaum sagen, was für kollektive Prozesse da im Inneren abliefen. (9)
Alquati argumentierte nicht nur theoretisch deutlich nüchterner. Dass er in seiner Untersuchungsarbeit konsequent von den „partikularen Erfahrungen“ der Arbeiter*innen ausging, bewahrte ihn auch vor revolutionären Allmachtsphantasien und parteipolitischen Ambitionen. Dagegen verloren Tronti und andere aus der römischen Gruppe die Vorgänge in den Fabriken mehr und mehr aus den Augen – mit der 1964 einsetzenden Rezession ebbten die Streiks ohnehin erstmal ab. Dagegen wurde wieder die kommunistische Partei der wichtigste Bezug für Tronti, der hoffte, die PCI „benutzen“ und gegen die Reformpolitik der PSI (der sozialistischen Partei, die seit 1963 zusammen mit den Christdemokraten regierte) auf einen revolutionären Kurs bringen zu können. Diese Annäherungsversuche stießen jedoch bei der Partei auf wenig Gegenliebe. Eher im Gegenteil: In einem im Frühjahr 1964 veröffentlichten Artikel griff z.B. die PCI-Zeitung L´Unità die Gruppe um Classe Operaia heftig an und beschuldigte sie, bezahlte Agenten des Kapitals zu sein.
Auch sonst blieb das Projekt, trotz aller hochgesteckten Ziele, politisch weitgehend einflusslos. 1967 hatte sich der Herausgeber*innenkreis hoffnungslos zerstritten. Die römische Fraktion trat wieder in die PCI ein, um künftig im Inneren der Partei eine „revolutionäre“ Politik zu betreiben. Die Veneto-Gruppe um Antonio Negri gründete derweil die Organisation Potere Operaio („Arbeitermacht“), die in den Fabrikkämpfen ab 1967 eine große, wenn auch nicht unbedingt glorreiche Rolle spielte. Ohnehin waren die Streiks und Unruhen des Jahres 1962 nur ein Vorgeplänkel. Im „Heißen Herbst“ 1969 schien die Revolution tatsächlich zum Greifen nah zu sein. Die autonomen Kämpfe der Arbeiter*innen bei FIAT und anderswo stürzten das italienische Kapital und den Staat in eine Krise, wie es sie nie zuvor gegeben hatte. Aber damit werde ich mich im nächsten Heft befassen.
Fussnoten Teil 3:
(1) Vgl. dazu die detaillierte Darstellung von Wolfgang Rieland im Vorwort von Wolfgang Rieland/Romano Alquati, „Klassenanalyse als Klassenkampf – Arbeiteruntersuchungen bei FIAT und OLIVETTI“, Athenäum Fischer, Frankfurt a.M. 1974.
(2) Schon in seiner Untersuchung bei OLIVETTI hatte er dies bemerkt: „Unter den Genossen, aber auch unter dem Arbeitern in Ivrea besteht ein grundsätzliches Misstrauen gegenüber der Soziologie: viel Aktivisten dort kennen sie nur allzu gut […] denn sehr viele der bekanntesten italienischen Soziologen – und insbesondere die ‚linken’ – sind bei OLIVETTI ausgebildet worden […] Die Soziologie, die bei OLIVETTI blühte – und noch immer blüht –, so sagen diese Genossen, ‚haben wir dann am eigenen Leibe ausprobieren dürfen’: in der Gestalt der neuen Arbeitsrhythmen.“ Vgl. Rieland/Alquati 1974, S. 103.
(3) www.kommunismus.narod.ru/knigi/pdf/Mario_Tronti_-_Arbeiter_und_Kapital.pdf
(4) Eine deutsche Übersetzung findet sich in Nanni Ballestrini/Primo Moroni: „Die goldene Horde – Arbeiterautonomie, Jugendrevolte und bewaffneter Kampf in Italien“, Assoziation A, Berlin 2002, S. 86ff.
(5) ebd. S. 87. Als geistiges Aufputschmittel für frustrierte Aktivist*innen funktioniert so eine Theorie natürlich wunderbar. Daraus erklärt sich wohl auch die Popularität Antonio Negris, der knapp vierzig Jahre später in seinem Bestseller „Empire“ noch ganz ähnliche Sätze von sich gab: „Tatsächlich erfindet das Proletariat die gesellschaftlichen Formen und die Formen der Produktion, die das Kapital für die Zukunft zu übernehmen gezwungen ist.“ (vgl.Antonio Negri/Michael Hardt, „Empire“, Campus Verlag Frankfurt/New York, 2002, S. 279).
(6) vgl. Ballestrini/Moroni 2002, S. 92. Bei den letzten beiden Sätzen halte mich hier allerdings an die Übersetzung von Bodo Schulze, da diese klarer verständlich ist. Vgl. Bodo Schulze: „Autonomia – Vom Neoleninismus zur Lebensphilosophie. Über den Verfall einer Revolutionstheorie“, in Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit, Nr. 10 (1989), S. 152. Schulze übt darin auch eine lesenswerte Kritik an Tronti und Negri. Online ist dieser Text unter www.wildcat-www.de/material/m009schul.htm zu finden.
(7) Zitiert nach Steve Wright: „Den Himmel stürmen. Eine Theoriegeschichte des Operaismus“, Assoziation A, Hamburg/Berlin 2005, S. 90.
(8) www.wildcat-www.de/thekla/06/t06wild2.htm
(9) Das war kein Mangel seiner Theorie, sondern aus der Sache selbst bedingt. Bodo Schulze drückt das ziemlich treffend aus: „Autonomie ist ein zerbrechlich Ding – oder vielmehr: Autonomie ist gar kein Ding, sondern eine bestimmte Verkehrsform von Individuen, die sich zum Zweck der Zerstörung jeglicher Herrschaftsverhältnisse assoziieren. Diese Verkehrsform ist nicht theoriefähig.“ Vgl. Schulze, a.A.o., S. 167.
Operaismus für Anfänger*innen (Teil 4)
In den ersten drei Teilen dieser Artikelserie habe ich die Entstehung der operaistischen Theorie nachzuzeichnen versucht: von der Gründung der Zeitschrift Quaderni Rossi und die „militanten Untersuchungen“ bei Olivetti und FIAT, über die Streiks und Riots von 1962, die schließlich zur Gründung der Gruppe Classe Operaia führten.
Bis dahin waren die Operaist*innen kaum mehr als eine linkskommunistische Splittergruppe. Ihre Untersuchungen in den Fabriken lieferten zwar aufschlussreiche Theorien, und ihre Interventionen waren wirkungsvoll genug, um die Routinen der Gewerkschafts- und Parteipolitik zu stören. Aber insgesamt waren sie weit entfernt, die kapitalistische Gesellschaft ernsthaft zu gefährden. Das änderte sich mit dem „Heißen Herbst“ von 1969. Eben diese ereignisreichen Jahre von 1968 bis 1973, in denen Italien nicht nur die größte Streikwelle nach dem 2. Weltkrieg erlebte, sondern wohl tatsächlich haarscharf an einer Revolution vorbei schrammte, will ich in diesem Teil behandeln.
Freilich lässt sich die Komplexität der Bewegung, die Vielzahl der Akteure und rasche Folge der Ereignisse hier nicht mal ansatzweise vollständig darstellen, sondern bestenfalls skizzieren – dies als dezente Warnung vorweg.
Arbeitermacht in Porto Marghera
Im Jahr 1967 war von den kommenden Unruhen noch wenig zu ahnen, und die Organisation Classe Operaia, die so etwas wie die Keimzelle der operaistischen „Bewegung“ bildete, hatte sich gerade in ihre Einzelteile zerlegt. Eine ganze Anzahl der Militanten (allen voran Mario Tronti) trat wieder in die PCI, die kommunistische Partei ein. (1) Die andere Fraktion entschied sich dafür, die eigene Unabhängigkeit zu bewahren und gründete die Organisation Potere Operaio („Arbeitermacht“) – oder besser Potere Operaio veneto-emiliano, abgekürzt PO-ve, so benannt nach den Regionen Emilio-Romagna und Venetien im Norden Italiens, auf die sich der Aktionsradius der Gruppe damals begrenzte.
Vorerst gelang es der Organisation nur in der Region von Porto Marghera an Einfluss zu gewinnen, wo sich in der Nähe von Venedig die petrochemische Industrie angesiedelt hatte. Dabei entbehrt es nicht einer gewissen Ironie, dass die PO-ve sich so ausgerechnet in einem Industriezweig festsetzen konnte, wo Angestellte und technisches Personal die Mehrheit bildeten, während sonst vor allem die unqualifizierten „Massenarbeiter“ im Fokus der operaistischen Debatte standen. (2)
Vor allem beim Unternehmen Montedison gelang es den Militanten, Kontakt zu den Beschäftigten aufzubauen und Einfluss zu gewinnen. Einen ersten großen Erfolg konnten sie dabei im Sommer 1968 erzielen. Aus Anlass der anstehenden Tarifverhandlungen, bei denen die Gewerkschaft wie üblich eine mäßige prozentuale Lohnerhöhung anpeilte, stellten die Aktivist*innen der PO-ve ihre eigene Forderung in den Raum: 10.000 Lire mehr im Monat, und zwar für alle! Von den Beschäftigten wurde dies begeistert aufgenommen, und auch die Gewerkschaft schloss sich widerwillig an, um die Kontrolle über die Lage nicht zu verlieren. Der Höhepunkt der Auseinandersetzung war im August 1968 erreicht, als tausende Streikende zur nahen Stadt Mestre zogen und die Verbindungsstraßen nach Venedig blockierten. Wenig später brach die Gewerkschaft den Streik ab und einigte sich mit dem Management, wie üblich, auf eine prozentuale Lohnerhöhung.
Die Forderung nach gleichen Lohnerhöhungen für alle kam in den Kämpfen dieser Jahre immer wieder auf. Den Arbeiter*innen war voll bewusst, dass das System der Lohnkategorien vor allem dazu diente, die Masse der Beschäftigten in viele kleine Untergruppen zu zerlegen und so die Macht der Unternehmer zu sichern. Und jede prozentuale Lohnerhöhung verstärkte die Unterschiede zwischen den Kategorien, weil in einer niedrigen Lohnkategorie natürlich auch die Erhöhung niedriger ausfiel.
Die Frage des Lohns war aber auch für die operaistische Theorie und Praxis dieser Zeit von zentraler Bedeutung. Schon der frühe Operaismus hatte die Planung als elementaren Bestandteil der kapitalistischen Wirtschaft erkannt. Das war einerseits ein deutlicher Fortschritt gegenüber dem Partei Marxismus, für den jedes „Mehr“ an Planung ein Schritt in Richtung Sozialismus war. Allerdings neigten die Operaist*innen dazu, nun ihrerseits in umgekehrter Richtung zu übertreiben. Ihre Befürchtung war, dass es durch ein Programm der staatlich gelenkten und geplanten Wirtschaftsentwicklung (wie es damals vor allem die sozialistische Partei PSI vertrat) gelingen könnte, die Kämpfe der Arbeiter*innen zu befrieden.
Von diesem Punkt aus lässt sich das Konzept des „politischen Lohns“ verstehen, das Mario Tronti schon Jahre zuvor formuliert hatte: „Vom Standpunkt der Arbeiterklasse aus ist ein Kampf dann politisch, wenn er bewusst die Krise der ökonomischen Abläufe der kapitalistischen Entwicklung herbeiführt.“ Und der Lohn schien der geeignete Hebel zu sein, um so eine Krise herbeizuführen, wie Tronti meinte: „Das Ungleichgewicht, das Auseinanderfallen von Löhnen und Produktivität, ist ein politischer Fakt. Er muss als solches verstanden und benutzt werden.“ (3) Wenn Lohnerhöhungen, die strikt an die Steigerung der Produktivität gekoppelt blieben, ein Mittel der Kontrolle waren, dann war die Entkopplung von Lohn und Produktivität ein Mittel der Revolution – so lautete der Umkehrschluss, der auch die Politik von Potere Operaio in den Kämpfen des „Heißen Herbsts“ bestimmte.
Unzufriedene Jugend
Entscheidender Auslöser für die landesweite Revolte waren dabei die Kämpfe bei FIAT, entsprechend der Rolle, die dieser Konzern in der italienischen Wirtschaft einnahm. Das Unternehmen produzierte 3% des Bruttoinlandsprodukts, 6% des Gesamtexports und 20% des Exports der Maschinenindustrie. Der Konzern besaß auch die zweitgrößte Tageszeitung Italiens, La Stampa, und hatte damit großen Einfluss auf die Politik und die „öffentliche Meinung“.
Die Erneuerung und Modernisierung der Anlagen war bei FIAT zu diesem Zeitpunkt weitgehend abgeschlossen. Steigerungen in der Produktivität wurden vor allem durch die immer stärkere Beschleunigung der Arbeitsrhythmen erzielt. Viele Beschäftigte sahen sich darum gezwungen der Arbeit tageweise fernzubleiben, um unter der Belastung nicht zusammenzubrechen – trotz der Lohneinbußen, die das zur Folge hatte. Rund 13% der Belegschaft waren so beständig abwesend. Zugleich verließen jedes Jahr etwa 10% der Beschäftigten das Unternehmen. Bei den neu Eingestellten waren es sogar 40%, die nach zwei oder drei Monaten wieder kündigten.

Im Vergleich zu den Gewinnen des Konzerns waren die Löhne im Laufe der 1960er nur unwesentlich gestiegen. Der gezahlte Grundlohn lag noch unter dem Existenzminimum. Die Arbeiter waren so zu allerlei Zusatzleistungen gezwungen, um über Prämien und Zulagen eine Summe zu erzielen, die halbwegs reichte, um die hohen Lebenshaltungskosten zu decken. Ein drängendes Problem waren vor allem die Wohnverhältnisse: Viele Arbeiter zahlten horrende Preise für ihre Schlafplätze, und hunderte mussten in den Bahnhöfen der Stadt oder im Auto übernachten, weil der Wohnungsbau mit dem Zustrom immer neuer Arbeitskräfte nach Turin bei weitem nicht Schritt hielt.
Gut die Hälfte der Turiner Stadtbevölkerung war wirtschaftlich direkt oder indirekt von FIAT abhängig. Und die Zahl der Beschäftigten in den Werken war in den vergangenen zwei Jahrzehnten rasch gestiegen, von 71.000 im Jahr 1952 auf beinahe 160.000 im Jahr 1968.
Der Großteil davon, 80%, waren Arbeitsmigranten aus dem Süden des Landes – eben jene „Massenarbeitern“, die ich in dieser Artikelreihe schon öfter behandelt habe. Die meisten von ihnen waren männlich (alleinstehend oder mit Familie), zwischen 20 und 30 Jahre alt, verfügten kaum über Schulbildung und übten in der Fabrik gering qualifizierte, monotone Tätigkeiten aus.
Gegen Ende der 1960er stellten diese jungen unqualifizierten Arbeiter die Mehrheit in vielen Unternehmen (wozu die Konzerne selbst viel beitrugen, indem sie in der Rezession ab 1965 gezielt vor allem Frauen und ältere Arbeiter entließen). Und sie waren auch das treibende Subjekt im „Heißen Herbst“ bei FIAT.
In ihrem Kampf gegen die Arbeit drückte sich praktisch aus, was Mario Tronti in marxistischer Theoriesprache einige Jahre zuvor so ausgedrückt hatte: Die Arbeiter müssten ihren eigenen Status als Ware infrage stellen, sich weigern, als Arbeitskraft zu fungieren, um das Kapitalverhältnis von innen heraus zu sprengen. Die Arbeiterklasse müsse folglich dahin kommen, „das gesamte Kapital zum Feind zu haben: daher auch sich selbst, insofern sie selbst Teil des Kapitals ist. Die Arbeit muss die Arbeitskraft, insofern sie Ware ist, als ihren eigenen Feind ansehen.“ (6) Das war abstrakt genug formuliert, ließ sich aber erstaunlich gut auf die Alltagslage der jungen Arbeiter übertragen – die meisten von ihnen hassten ihren Job und wollten ihr Dasein als Lohnabhängige lieber heut als morgen beenden.
Allerdings war es nicht Mario Tronti, der diese jungen Arbeiter politisierte und zum Widerstand anregte. Weitaus wichtiger war dabei die Studentenbewegung, die ab 1967 auch in Italien als neue Kraft eindrucksvoll in Erscheinung trat – mit Universitätsbesetzungen, Demonstrationen und Kämpfe mit der Polizei.
Die studentischen Militanten suchten dabei von Anfang an den Schulterschluss mit der Arbeiterschaft. Viele von ihnen stammten selbst aus proletarischen Familien, finanzierten sich das Studium mit mies bezahlten Gelegenheitsjobs und wohnten in denselben Vierteln wie die Arbeitsmigranten aus dem Süden. So entstand ein gemeinsames Milieu der Unzufriedenen, in dem auch die Theorien der operaistischen Gruppen an Einfluss gewannen. Indem sich der studentische Protest mit den Revolten und wilden Streiks in den Fabriken verband, gewann die Bewegung eine Brisanz und Ausdauer, die europaweit einzigartig war – letztlich sollte es in Italien ein rundes Jahrzehnt dauern, bis diese Revolte beendet war.
Revolte bei FIAT
Aber der Reihe nach. Schon 1967 hatten junge Aktivist*innen damit begonnen, vor den Werkstoren bei FIAT zu agitieren und Flugblätter zu verteilen. So entstanden erste Kontakte zu den Arbeitern und in die einzelnen Werkstätten hinein.
Bereits 1968 kam es bei FIAT zu ersten Streiks. Aber der ganze angestaute Unmut entlud sich erst im Frühjahr 1969. In der Metallindustrie standen neue Tarifverhandlungen an. Die Gewerkschaften planten, nach dem üblichen Modus zu verfahren: erste Verhandlungen in den Sommermonaten, wenn die meisten Beschäftigten im Urlaub waren. Danach einige weitgehend symbolische Arbeitsniederlegungen, die für FIAT keine ernsten Einbußen brachten – die meisten Aufträge wurden vor der Sommerpause abgearbeitet, und da war der Konzern auch besonders auf reibungslose Abläufe angewiesen.
Nur diesmal lief es anders. Schon ab April 1969 kam es im FIAT-Werk von Mirafiori immer öfter zu Versammlungen, und schließlich wurde in einer Kundgebung von 8000 Arbeitern ein Streik beschlossen. Die Initiative dazu kam von den gewerkschaftlich organisierten Facharbeitern, die für die Wartung der Anlagen zuständig waren. Sie forderten u.a. Lohnerhöhungen und die Abschaffung der niedrigsten Kategorie. Ab 11. Mai 1969 begann eine Reihe von je zweistündigen, noch gewerkschaftlich kontrollierten Arbeitsniederlegungen. Bald schlossen sich andere Abteilungen an, die Arbeiter der Zulieferabteilungen traten nun auf eigene Initiative in den Streik. Dadurch wurde der gesamte Produktionsablauf stillgelegt. Und als die Arbeit an den Montagebändern stockte, wo der Großteil der jungen „Massenarbeiter“ beschäftigt war, traten auch diese in den Streik und trugen im Folgenden viel dazu bei, die Formen der Auseinandersetzung zu radikalisieren – durch zeitweilige Besetzung einzelner Abteilungen, durch Sabotage, durch Militanz auf der Straße, aber auch durch neue und kreative Aktionsformen. So wurden etwa mit Demonstrationszügen durch die Fabrik die noch unbeteiligten Kollegen agitiert, sich den Streiks anzuschließen.
Bald entstand eine regelmäßige „Versammlung der Arbeiter und Studenten“, die sich nach Schichtende in einem Lokal nahe Mirafiori trafen. Daraus wurde ein regelmäßiges Treffen, bei dem die Arbeiter der verschiedenen Werkstätten Informationen austauschten und Aktionen für die folgenden Tage geplant wurden (5).
Die allgemeineren Probleme und Fragen der Strategie wurden auf Versammlungen debattiert, die bald regelmäßig jeden Sonntag stattfanden. Aus diesem Kreis heraus entstanden Flugblätter, die vor den Fabriktoren verteilt und mit der Formel „la lotta continua“ (der Kampf geht weiter) unterzeichnet wurden – nach dieser Losung benannte sich später die gleichnamige Organisation, von der weiter unten noch die Rede sein wird.
Gewerkschaften und Bosse
Die Gewerkschaften sahen sich durch dieses autonome Handeln der Arbeiter in Bedrängnis gebracht. Sie mühten sich, die allgemeine Revolte in eine geregelte Choreografie zu überführen, bei der nur in einzelnen Abteilungen der Reihe nach gestreikt und gesondert verhandelt wurde. Das misslang erstmal gründlich. So begannen am 29. Mai die Arbeiter auf eigene Faust zu streiken, ohne den von den Gewerkschaften angesetzten Termin abzuwarten. Und als die Gewerkschaften Mitte Juni einen neuen Vertrag für die Arbeiter an den Montagebändern präsentierten, reagierten diese mit offener Ablehnung und traten zwei Tage später erneut in den Streik.
Andererseits konnten die Gewerkschaften die Unruhe nutzen, um ihre eigene Position stärken, die bei FIAT traditionell eher schwach war. Bereits 1955 hatte FIAT die meisten Kader der Metallgewerkschaft FIOM und der kommunistischen Partei gefeuert und zugleich eine eigene „gelbe“ Gewerkschaft gegründet. So war Ende der 1960er der Einfluss der unabhängigen Gewerkschaften bei FIAT gering – nur ein Viertel der Beschäftigten war in ihnen organisiert.
Ihre wichtigste Forderung war nun die Anerkennung sog. „Abteilungsdelegierter“, mit denen sie ihre Entscheidungsmacht im Werk zu vergrößern hofften. Mit Erfolg: Der Abschluss am 27. Juni 1969 beinhaltete u.a. die Anerkennung von 56 solcher Delegierten. Ebenso wurden Abteilungskomitees (comitati di linea) eingerichtet, die jeweils mit vier Repräsentanten je einer Gewerkschaft besetzt wurden.
Die Konzernleitung, zumindest deren „progressiver“ Flügel, war durchaus zum Entgegenkommen an diesem Punkt bereit. Denn damit die Gewerkschaften von den Arbeitern als offizielles Vertretungsorgan anerkannt wurden, mussten sie auch Erfolge vorweisen können, und dafür mussten man ihnen größere „Rechte“ zugestehen. Darüber war sich auch die Konzernleitung klar, wie sich deutlich an der Berichterstattung der von FIAT kontrollierten Tageszeitung La Stampa und dem Tenor der dort veröffentlichten Artikel zeigte. Zugleich versuchte La Stampa aber auch, gegen die linksradikalen „Agitatoren“ Stimmung zu machen, und intern legte die Konzernleitung Listen mit den Namen vermeintlicher Rädelsführer an, die bei nächster Gelegenheit entlassen oder versetzt werden sollten.
Für den 3. Juli riefen die Gewerkschaften zum Generalstreik in Turin auf, um gegen den „Mietwucher“ zu protestieren und beim Parlament Aufmerksamkeit für ihre Forderungen zu schaffen. Sie verfehlten jedoch ihr Ziel, einerseits die Initiative und damit die Kontrolle zurückgewinnen, andererseits den Unmut auf andere Ziele zu lenken. Gegen Mittag sammelte sich vor dem Werk in Mirafiori ein etwa 3000 Personen starker Demonstrationszug von Arbeiter*innen und Student*innen. Dieser wurde fast unmittelbar von der Polizei angegriffen. Das ließ die Lage eskalieren. Barrikadenkämpfe begannen, die bis in die Nacht dauerten und sich bis in die Vororte der Stadt ausbreiteten. Am Ende mussten die Polizeikräfte sich zurückziehen.
Die „organisierte Autonomie“ und der Staat
Nach dem 3. Juli breiteten sich die Kämpfe auf andere Industriezweige und Regionen aus. Bei Alfa Romeo, Innocenti, Sit-Siemens, Seat, Michelin, Lancia und Phillips wurde ebenso gestreikt wie bei Olivetti, in den Chemiefabriken von Porto Marghera ebenso wie in Rom, Bologna, Pisa und Florenz. Und auch bei FIAT gingen die Arbeitskämpfe nach der Sommerpause unvermindert weiter. Die Konzernleitung setzte nun auf harte Repression und begnügte sich nicht mehr damit, einzelne „Rädelsführer“ zu entlassen. Ihre Maßnahmen richteten sich vielmehr gegen alle, die an den Streiks beteiligt waren. Am 3. September wurden so insgesamt 40.000 Arbeiter „suspendiert“, die Hälfte davon aus Mirafiori. Am Folgetag stürmten mehrere tausend der Entlassenen das Fabriksgelände, zogen durch die Werkstätten und zettelten dort Versammlungen und Diskussionen an.
Die Bewegung weitete sich aus, trotz der Repression, die auch von der Polizei ausgeübt wurde. Am Generalstreik am 19. November beteiligten sich schließlich etwa 20 Millionen Arbeiter*innen. In diesem Kontext entwickelte sich Potere Operaio zu einer landesweiten Organisation mit zeitweilig bis zu 4000 Mitgliedern. Schon ab Frühjahr 1969 gab sie die Zeitung La Classe heraus, die ab Herbst auch überregional im Wochentakt erschien und für die Debatten der Bewegung sehr wichtig war. Daneben entwickelte sich Lotta Continua zur größten Gruppe der „organisierten Autonomie“. Ursprünglich wurde sie von studentischen Aktivist*innen gegründet, die nach Turin gekommen waren, um bei den FIAT-Kämpfen mitzumischen, und bildete sich bald zu einer landesweiten Organisation weiter. Ab November 1969 gab sie eine eigene Zeitung heraus. Die Organisation war auch weiterhin stark in der studentischen Linken verankert, hatte aber auch unter den jungen Fabrikarbeiter*innen großen Einfluss.
Auch die Militanten dieser Gruppen sahen sich einer zunehmenden staatlichen Repression ausgesetzt. Eine drastische Wendung erhielt die Situation durch die Bombenanschläge vom 12. Dezember 1969. Eine Bombe detonierte in der Mailänder Landwirtschaftsbank, 16 Menschen wurden getötet und weitere 80 verletzt. Auch in Rom explodierten drei Bomben, hier gab es keine Toten, aber viele Verletzte. Tatsächlich waren diese Anschläge von faschistischen Gruppen durchgeführt und von staatlichen Instanzen, Militär und Geheimdiensten, unterstützt worden. Die Polizei konzentrierte sich mit ihren Ermittlungen aber ausschließlich auf die radikale Linke und konnte umgehend die angeblichen Täter präsentieren. Eine Reihe von Anarchisten wurde verhaftet. Einer von ihnen, Pino Pinelli, stürzte bei einem Verhör aus einem Fenster im vierten Stock und starb.
Um diese Zusammenhänge halbwegs erschöpfend darzustellen, wäre freilich mindestens ein eigener Artikel notwendig (6). Jedenfalls erfüllte das „Staatsmassaker“ von Mailand seinen unmittelbaren Zweck. Es begann eine Pressekampagne gegen die Streikenden und die studentischen Unruhestifter. Unter diesem Druck beeilten sich die Gewerkschaften zu verhandeln. Am 21. Dezember 1969 wurde der letzte Tarifvertrag bei FIAT abgeschlossen. Der „Frieden“ war vorerst gerettet.
Die staatliche Repression und die geheimdienstliche „Strategie der Spannung“ sollten die linke Bewegung die ganzen 1970er hindurch prägen und langfristig auch zu ihrem Ende führen. Mittelfristig führten sie dazu, dass sich die Politik großen linksradikalen Gruppen, Potere Operaio und Lotta Continua, von den Fabriken auf die Straße verlagerte. Antifaschistische Demonstrationen und Kämpfe mit der Polizei spielten eine immer größere Rolle. Zugleich verschärften und verengten sich die internen Debatten – die Konfrontation mit der Staatsmacht wurde nun zum wichtigsten Punkt. Der „Aufbau der bewaffneten Partei“ wurde eine gängige Parole, sowohl bei Potere Operaio als auch bei Lotta Continua.

Dies war dem Anspruch der Gruppen, von den Kämpfen „an der Basis“ auszugehen, eigentlich diametral entgegengesetzt. Dieser Widerspruch ließ sich letztlich nicht lösen – und zumindest die Aktivist*innen von Potere Operaio waren konsequent genug, sich dies einzugestehen und beschlossen auf der letzten nationalen Konferenz der Organisation im Mai 1973 die Auflösung. Mit den Ursachen dieser Entscheidung werde ich mich im nächsten Heft noch beschäftigen. Dabei wird vor allem die feministische Gruppe Lotta Femminista im Fokus stehen, die als Abspaltung von Potere Operaio entstand und die operaistische Kritik der „produktiven Arbeit“ in der Fabrik um eine Kritik der Hausarbeit erweiterte. Damit spielte sie nicht nur für die italienische Frauenbewegung, sondern auch die autonome Bewegung der 70er Jahre eine wichtige Rolle. Im letzten Teil dieser Artikelreihe will ich dann vor allem Toni Negri Thesen vom „gesellschaftlichen Arbeiter“ als neuem revolutionären Subjekt beleuchten. Ihr dürft gespannt sein.
Fussnoten Teil 4:
(1) Wichtige Hinweise zu Trontis weiterer Entwicklung gibt Theodor Sander: „Von der Theorie der Arbeitersubjektivität zur antiproletarischen Propaganda“, Universität Osnabrück 1999.
(2) Bezeichnend ist die Haltung Mario Trontis, der 1967 das technische Personal als „eine Handvoll Techniker“ abtat, „die sich damit brüsten, Mehrwert zu produzieren, indem sie Knöpfe drücken“. Vgl. Steve Wright: „Den Himmel stürmen. Eine Theoriegeschichte des Operaismus“, Assoziation A, Hamburg/Berlin 2005, S. 115
(3) zitiert nach Steve Wright 2005, S. 78.
(4) Mario Tronti, „Arbeiter und Kapital“, online unter www.kommunismus.narod.ru/knigi/pdf/Mario_Tronti_-_Arbeiter_und_Kapital.pdf, vgl. „Fabrik und Gesellschaft“, S.22 im PDF.
(5) Wolfgang Rieland (Hg.): „FIAT-Streiks – Massenkampf und Organisationsfrage“, Trikont Verlagskooperative München, 1970, S. 72.
(6) Literatur zum Thema ist jedenfalls genug vorhanden. Vgl. z.B. Luciano Lanza: „Bomben und Geheimnisse – Geschichte des Massakers von der Piazza Fontana“, Edition Nautilus, Hamburg 1999, oder Dario Fos Theaterstück „Zufälliger Tod eines Anarchisten“, das die Ereignisse literarisch verarbeitet.
Operaismus für Anfänger*innen (Teil 5)
Bislang habe ich in dieser Artikelreihe dargestellt, wie sich die operaistische Theorie und Bewegung vom Ende der 1950er Jahre bis 1970 entwickelte. Den weiteren Verlauf werde ich in den letzten beiden Teilen sozusagen im Schnelldurchlauf behandeln. Nicht etwa, weil dazu nichts Wichtiges mehr zu sagen wäre – die Schwierigkeit besteht vielmehr darin, dass die Lage ab diesem Zeitpunkt zusehends unübersichtlich wird.
Ein kurzer Überblick darüber, wie sich die operaistische Bewegung organisatorisch entwickelte, mag das Problem verdeutlichen: Ganz zu Anfang, 1960, bestand sie nur aus einer Handvoll linker Aktivist*innen, die sich um die Zeitung Quaderni Rossi sammelten und Untersuchungen in den Fabriken durchführten. Erst wesentlich später im „Heißen Herbst“, den wilden Streiks von 1969, gewann der Operaismus eine wirkliche Massenbasis. Hier wurde die Szenerie durch die großen Gruppen der „organisierten Autonomie“, namentlich Potere Operaio und Lotta Continua geprägt, die mit jeweils mehreren tausend Mitgliedern landesweit aktiv waren.
Dagegen entstand Anfang der 70er eine neue autonome Bewegung, die durch zahllose kleine Gruppen und lose, informelle Zusammenhänge geprägt war. Neue Subjekte, Frauen, Arbeitslose, Jugendliche usw. traten mit eigenen Forderungen auf den Plan. Die Autonomia knüpfte einerseits an die vorangegangenen Kämpfe der Fabrikarbeiter*innen an, weitete den Konflikt aber auf ein größeres Terrain aus und entwickelte eine Kritik und Praxis, die alle Aspekte des Alltagslebens einbezog – von der Wohnsituation bis zur Kindererziehung, vom Bildungssystem bis zur Lage in den psychiatrischen Einrichtungen und Knästen…
„Organisierte Autonomie“ und Frauenbewegung
Der erste Anstoß für diese Neuzusammensetzung der sozialen Kämpfe „von unten her“ kam dabei von Aktivistinnen der neuen Frauenbewegung, die 1970 entstand. Viele, wenn nicht die meisten dieser Frauen waren in den einschlägigen linken Organisationen sozialisiert worden. Sie machten aber rasch die Erfahrung, dass sie dort – egal wie „revolutionär“ sich diese Organisationen nach außen darstellen mochten – doch immer nur eine untergeordnete Stellung gegenüber den männlichen Militanten einnahmen. Die logische Antwort war, sich unabhängig zu organisieren, autonom sowohl den etablierten Parteien und Gewerkschaften als auch den großen linksradikalen Organisationen gegenüber. (1)

Dies betraf auch die operaistischen Gruppen, allen voran Potere Operaio. So traten 1971 eine ganze Reihe von Aktivistinnen, darunter Mariarosa Dalla Costa, Leopoldina Fortunati und andere, aus der Organisation aus. Daraus entstand bald eine neue Gruppe, nämlich Lotta Femminista („Feministischer Kampf“), die in der italienischen und internationalen Frauenbewegung eine wichtige Rolle spielte.
Zu den Gründen ihres Austritts erklärt die Feministin Mariarosa Dalla Costa im Rückblick: „Wenn ich gefragt würde, warum ich Potere Operaio im Juni 1971 verließ und eine Gruppe von Frauen sammelte, aus der später der erste Keim von Lotta Femminista wurde, dann würde ich antworten: ‚Es war eine Sache persönlicher Würde’. Zu dieser Zeit war das Verhältnis von Mann und Frau, gerade in diesem Umfeld von intellektuellen Genossen, nicht so, dass ich mich hinreichend gewürdigt fühlen konnte.“ (2)
Das Problem war freilich nicht nur, dass sich das Rollenverhalten der männlichen Aktivisten nicht unbedingt positiv von der Mehrheitsgesellschaft abhob. Auch in den theoretischen Debatten bei Potere Operaio fand die Lebenslage der weiblichen Lohnabhängigen keine Beachtung. Vielmehr wurde das „Proletariat“ fast selbstverständlich als „männlich“ vorausgesetzt. Das hatte sicher auch reale Gründe – die niedrig qualifizierten „Massenarbeiter“, welche Ende der 60er Jahre die zahlenmäßig größte Fraktion der Arbeiterschaft in den norditalienischen Industriegebieten darstellten, waren ja tatsächlich zum Großteil junge Männer.
Bei FIAT waren bis zum „Heißen Herbst“ von 1969 überhaupt keine Frauen in der Produktion tätig – erst Anfang 1970 und in Reaktion auf die wilden Streiks begann die Konzernleitung Tausende von jungen Frauen einzustellen. Damit wurden einerseits die männlichen Montagearbeiter an den Fließbändern ersetzt, die in den vorangegangenen Kämpfen eine treibende Rolle gespielt hatten. Zugleich nutzte das Unternehmen die Chance, um die Lohnkosten zu senken: Die Frauen übten zwar eine Tätigkeit aus, die der dritten Lohnkategorie entsprach, sie wurden aber nach der (niedrigeren) vierten Lohnkategorie bezahlt.
Das warf Fragen auf, die von den männlichen Theoretikern von Potere Operaio allerdings nur mit wenigen flapsigen Worten abgetan wurde, wie in einem Artikel vom Februar 1970: „Die Einstellung von Frauen bei FIAT Mirafiori ist vergleichbar mit der Einstellung von Schwarzen in der Autoindustrie von Detroit in den dreißiger Jahren. Es ist Zeit damit aufzuhören, vor lauter Sorge um die ‚Gleichstellung’ der Frauen zu vergehen, die wie jede Unterweisung in Sachen Bürgerrechten vollkommen daneben ist. Das Kapital hat die Frauen bei Mirafiori längst ‚gleichgestellt, indem es sie an die Fließbänder geschickt hat.“ (3) Es handelte sich um ein Spaltungsmanöver des Kapitals, die Frauen sollten sich eben organisieren und den Kampf der männlichen Arbeiter unterstützen – ein besonderes Problem gab es da nicht.
Diese Analyse war sicherlich mangelhaft und trug eher dazu bei, gerade die Spaltungen zwischen verschiedenen Fraktionen des Proletariats zu befördern, die sie doch verhindern wollte. Dazu stellt die italienische Feministin Leopoldina Fortunati, fest: „Die Debatte bei Potere Operaio war sehr weit entwickelt, soweit es darum ging, die neuen Fabriken, die Rolle der neuen Arbeitergeneration innerhalb des gegenwärtigen kapitalistischen Systems zu analysieren, aber sie war sehr arm in Bezug auf Fragen der Hausarbeit, Affekte, Emotionen, Sexualität, Bildung, Familie, zwischenmenschliche Beziehungen, Miteinander usw.“ (4)
Bei aller Kritik betont Fortunati aber auch, wie wichtig die Leistungen der operaistischen Theoretiker für sie gewesen seien: „Sie verwandelten das Vermächtnis der Marxschen Theorie in etwas Dynamisches und nutzten es, um die Gesellschaft in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts analysieren und verstehen zu können, und das war es, was sie den Graswurzelaktivist_innen wie mir mitgaben: die Fähigkeit, Marx ohne falsche Ehrerbietung zu nutzen.“ (4)
Mit anderen Worten: Der Operaismus bot ein brauchbares theoretisches Rüstzeug, mit dem sich auch die Stellung der Frauen innerhalb der kapitalistischen Arbeitsteilung besser verstehen ließ – es war nur nötig, dieses Rüstzeug angemessen respektlos zu gebrauchen.
Kritik der Hausarbeit
Genau das taten die Feministinnen auch, und erweiterten dabei die operaistische Kritik der Fabrikarbeit um eine Kritik der Hausarbeit. Die Grundzüge dieser Analyse entwickelte Dalla Costa in ihrem Text „Die Macht der Frau und die Umwälzung der Gesellschaft“ (5). Dieser war zunächst als internes Papier für die Debatten bei Potere Operaio verfasst, wurde von Dalla Costa aber später überarbeitet und als Broschüre veröffentlicht. Der Text fand in der internationalen feministischen Bewegung großen Anklang und wurde mehrfach übersetzt.
Dalla Costa zufolge beruht die Macht des Kapitals nicht allein auf der produktiven Arbeit des „doppelt freien Lohnarbeiters“. Das Kapital ist ebenso auf die unbezahlte Arbeit der Frauen angewiesen, die nötig ist, um die Arbeitskraft des (männlichen) Lohnarbeiters zu reproduzieren. „Seit Marx ist klar, dass das Kapital mittels des Arbeitslohns herrscht und sich entwickelt, das heißt, dass der oder die Lohnarbeiter_in und deren Ausbeutung die Basis der kapitalistischen Gesellschaft bildet. Was weder klar war noch seitens der Organisationen der Arbeiterbewegung bemerkt wurde, war der Fakt, dass genau durch den Arbeitslohn die Ausbeutung der unbezahlten Arbeit organisiert wurde. […] Das heißt, über den Lohn wurde eine größere Menge an Arbeit kommandiert, als in der für die Fabrikarbeit gezahlten Geldsumme auftauchte.“
Dass diese Arbeit prinzipiell ohne Lohn geleistet wurde, wirkte sich nicht nur auf die Profitrate aus. Es trug auch dazu bei, zu verschleiern, dass es sich an dieser Stelle überhaupt um ein Zwangs- und Ausbeutungsverhältnis handelte. Diese Arbeit der Frauen schien vielmehr „ein persönlicher, außerhalb des Kapitalverhältnisses geleisteter Dienst zu sein.“ Ihre Funktion „im Zyklus der gesellschaftlichen Produktion blieb unsichtbar, weil von dort aus nur das Endprodukt ihrer Arbeit, der Arbeiter, zu sehen war. Sie selbst blieb dabei in prä-kapitalistischen Arbeitsverhältnissen gefangen“.
Lotta Femminista waren, ähnlich wie Potere Operaio, vor allem in den norditalienischen Regionen Veneto und Emiliana aktiv, ebenso in Rom. Die Gruppe war in ihrer Tätigkeit aber auch sehr stark international ausgerichtet. So wurde 1972 in Padua das International Feminist Collective gegründet, ein Netzwerk, das neben Italien auch in den USA und Kanada, aber auch in Großbritannien und Deutschland sehr aktiv war. Aus diesem heraus wurde eine internationale Kampagne gestartet – „Lohn für Hausarbeit“. (5)
Internationale Debatten
Die Forderung stieß innerhalb der Frauenbewegung keinesfalls auf ungeteilte Zustimmung. Im Gegenteil sahen viele Feministinnen gerade die gleichberechtigte Teilhabe am Erwerbsleben als das beste Mittel, um die Emanzipation der Frauen voranzubringen. Eine Bezahlung für Hausarbeit einzufordern, schien ihnen dagegen vor allem eine Bestätigung des Status quo zu sein und wurde von ihnen harsch kritisiert.
Demgegenüber verteidigte die in den USA lebende Feministin Silvia Federici, ein Gründungsmitglied des International Feminist Collective, in einem Text von 1974 die Kampagne gegen etwaige Missverständnisse. Es handle sich vielmehr um einen „Lohn gegen Hausarbeit“ (6). Die Lohnforderung sei nur das gewählte Mittel, nicht etwa das Ziel der Kampagne. Die Forderung bedeute auch nicht, „dass wir diese Arbeit weiterhin verrichten werden, sofern wir dafür bezahlt werden. Es bedeutet genau das Gegenteil.“
Denn Hausarbeit sei eben keine Arbeit „wie jede andere”: „Einen Lohn zu erhalten, heißt Teil eines Vertragsverhältnisses zu sein, und es gibt keine Unklarheit, was dessen Inhalt betrifft: Du arbeitest, nicht weil du es gerne tust oder weil es dir eben so einfällt, sondern weil dir nur unter dieser Bedingung erlaubt wird zu leben. Aber egal wie sehr du auch ausgebeutet wirst, du bist mit deiner Arbeit nicht identisch.”
Bei der Hausarbeit stelle sich dies grundlegend anders dar. Diese sei zwar ebenfalls ein Ausbeutungsverhältnis – aber gerade weil für die geleistete Arbeit kein Lohn gezahlt werde, erscheine sie nicht als Arbeit im eigentlichen Sinn. Es sei nicht nur so, dass die Hausarbeit den Frauen zugeteilt und aufgezwungen werde, zugleich „wurde sie in ein scheinbar natürliches Merkmal unserer Körperlichkeit und Persönlichkeit als Frauen verwandelt, in ein inneres Bedürfnis, ein Drang, der angeblich aus den Tiefen unseres weiblichen Charakters entspringt.“
Die Ausbeutung würde also verschleiert und mystifiziert – sie erscheine als Produkt der „Liebe“ oder der „weiblichen Natur“. Genau diese Mystifikation solle mit der Kampagne durchbrochen werden, die Lohnforderung solle die Hausarbeit wieder als Zwangs- und Ausbeutungsverhältnis kenntlich machen.
Von diesem Punkt aus kritisierte Federici auch die Institution der Kleinfamilie. Trotz aller romantischer Vorstellungen, die sich daran knüpften, stelle diese die kleinste basale Einheit der kapitalistischen Gesellschaft dar. Die Ausbeutung im Haushalt lasse sich nur im Verhältnis zur Ausbeutung in der Fabrik verstehen: „Es ist kein Zufall, dass die meisten Männer gerade dann anfangen an Heirat zu denken, wenn sie ihren ersten Job kriegen. Nicht nur, weil sie es sich leisten können – jemanden zu Hause zu haben, der sich um einen kümmert, ist die einzige Möglichkeit, nach einem langen Tag am Fließband oder Schreibtisch nicht durchzudrehen. […] Und auch in diesem Fall gilt, dass die Sklaverei der Frau sich umso tiefgreifender gestaltet, je ärmer die Familie ist, und dies nicht nur aus monetären Gründen. Tatsächlich verfolgt das Kapital eine doppelte Politik, eine für die Mittelklasse und eine für die proletarische Familie. Es ist kein Zufall, dass wir den stumpfesten Machismo gerade in Familien der Arbeiterklasse finden: Je mehr Schläge der Mann auf Arbeit einstecken muss, umso mehr muss die Frau darauf getrimmt sein, sie aufzufangen, umso mehr wird es ihm freigestellt, sein Ego auf ihre Kosten.wieder aufzubessern. Du schlägst deine Frau, wenn du frustriert oder fertig von der Arbeit bist oder wenn du eine Niederlage einstecken musstest (und zur Arbeit in die Fabrik zu gehen ist an sich schon eine Niederlage).“
Federici erklärte es für absurd, diesen Kampf der Frauen für eine Bezahlung ihrer Arbeit mit den Lohnkämpfen zu vergleichen, wie sie von den männlichen Fabrikarbeitern geführt wurden. Die Ausgangslage stelle sich bei den Hausfrauen nämlich komplett anders dar: „Der Lohnarbeiter stellt, indem er mehr Lohn fordert, seine soziale Rolle in Frage und bleibt doch in ihrem Rahmen. Wenn wir für eine Bezahlung unserer Arbeit kämpfen, dann kämpfen wir ohne Zweideutigkeit und direkt gegen unsere soziale Rolle.“
Dabei ginge es nicht darum, sich „einen Platz innerhalb der kapitalistischen Verhältnisse zu erkämpfen, weil wir niemals außerhalb derselben waren.“ Das Ziel sei vielmehr, den kapitalistischen Plan zu durchkreuzen, das Kapital anzugreifen und damit zu zwingen, „die sozialen Verhältnisse in einer Weise neu zu strukturieren, die für vorteilhafter für uns selbst ist und in der Folge auch vorteilhafter, um eine Einigkeit der Klasse zu erreichen.“
Italienische Verhältnisse
Das war ziemlich nah an der politischen Linie, die auch Potere Operaio in den Jahren von 1969 bis 1973 verfolgten. So erinnerte der „Lohn für Hausarbeit“ nicht von ungefähr an das Konzept des „politischen Lohns“, also die Strategie, mit immer neuen Lohnforderungen das Kapital in die Krise zu treiben – nur mit dem von Federici erwähnten Unterschied, dass die männlichen Lohnarbeiter dabei allemal „im Rahmen ihrer Rolle“ blieben. So gerieten Potere Operaio rasch in eine Krise, zumal sie sich nicht nur strategisch eingleisig auf immer neue Lohnforderungen festlegten, sondern sich zugleich auch in ihrer Klassenanalyse ziemlich verrannten und alle Akteur_innen abseits der jungen, unqualifizierten, männlichen „Massenarbeiter“ weitgehend ignorierten. Welche Folgen dies für die operaistischen Debatten hatte, werde ich im nächsten (letzten) Teil dieser Serie noch genauer darstellen.
Jedenfalls liefen die feministischen und die operaistischen Debatten in ihrer weiteren Entwicklung weitgehend bezugslos nebeneinander her – wie Mariarosa Dalla Costa im Rückblick feststellte (2): „Ich selbst hatte meine ersten Schritte bei Potere Operaio gemacht, deswegen war es frustrierend zu sehen, wie sehr diese ganze Debatte abgeblockt wurde. Männliche Genossen, die nichts über die Entwicklung unseres Diskurses oder die für uns zentralen Themen wussten, konnten uns nicht folgen und nur auf dem Niveau von Höhlenmenschen argumentieren wenn sie mit uns zusammentrafen. Umgekehrt blieben ihre Debatten für uns undurchschaubar, während es dringend nötig gewesen wäre, eine gemeinsame Diskussion zu führen.“
Zugleich wuchs die Frauenbewegung in Italien rasch. So versammelten sich bei einer landesweiten Konferenz 1974 etwa 10.000 Frauen, und am 18. Januar 1975 fand in Rom eine große Demonstration für die Legalisierung der Abtreibung mit 20.000 Teilnehmerinnen statt – das waren Größenordnungen, die im internationalen Vergleich wohl einzigartig waren.
Die Bewegung erhielt teilweise Unterstützung durch die Gewerkschaften und Organisationen der radikalen Linken – so bildeten sich z.B. bei Lotta Continua eigene Frauengruppen. Zugleich blieb das Verhältnis zwischen der Frauenbewegung und der restlichen Linken gespannt. So kam es am Rande der erwähnten Anti-Abtreibungs-Demonstration 1975 zu Handgreiflichkeiten, als einige männliche Aktivisten die Reihen des Ordnungsdienstes durchbrechen wollten.
Alisa Del Re, eine andere ehemalige Aktivistin von Potere Operaio, die aber von dort zur kommunistischen Partei wechselte, bemerkte dazu: „Ich hatte mit Frauen zu tun, die in außerparlamentarischen Gruppen aktiv und zugleich Feministinnen waren, und die waren zu dramatischen Entscheidungen gezwungen […] Der Gegner war oft im eigenen Heim: Wenn eine Frau persönliche Autonomie erlangen und zugleich die Beziehungen aufrecht erhalten wollte, zu Geliebten, Freunden, Gatten, Vätern oder zu Männern, die in der Linken engagiert waren und somit viele ihrer Ideen von einem grundsätzlichen Wandel der Gesellschaft teilten, dann war das für sie mit viel Unbehagen verbunden.“ (8)
Während die männlichen Aktivisten den Feministinnen ihren „Separatismus“ vorwarfen, kritisierte die Frauenbewegung umgekehrt die Aktionsformen der Linksradikalen – allen voran die Gewalt bis hin zum Schusswaffengebrauch bei Demonstrationen, die sich oft genug mit allerlei Macho-Attitüden verband. In strategischer Hinsicht sollten die Feministinnen damit recht behalten: Die zunehmende Militarisierung der autonomen Bewegung (wobei natürlich auch die harte, von der Polizei ausgehende Gewalt ihre Rolle spielte) führte zunehmend in eine Sackgasse. Ab 1978 – nachdem der ehemalige Ministerpräsident Aldo Moro durch die Stadtguerillagruppe der Roten Brigaden ermordet worden war – wurde die radikale Linke durch massive staatliche Repression zerschlagen, viele hunderte Aktivist*innen wanderten ins Gefängnis.
Im Zuge dessen wurde auch die feministisch-marxistische Theorielinie von Lotta Femminista aus dem akademischen und allgemeinen Diskurs verdrängt, wie Mariarosa Dalla Costa beschreibt: „In den 1980ern, Jahren der Repression und Normalisierung, ersetzte eine grundlegend ‘kulturelle’ Ausformung des Feminismus diese großen Kämpfe und Forderungen, und das hatte die Funktion, die Forderungen und Wortmeldungen der Frauen zu kontrollieren und zu selektieren. […] Zu sagen, dass unsere Arbeiten nicht frei zirkulieren konnten, wäre noch allzu beschönigend ausgedrückt. Sie verschwanden geradezu, […] sie wurden überwältigt, von einen entgegengesetzten politischen Willen und einer Unmenge an Studien zur ‘Frauenfrage’, die von einer gänzlich anderen Perspektive aus durchgeführt wurden.“ (2)
Fussnoten Teil 5:
(1) Darauf verweist z.B. Patrick Cuninghame: „Italian feminism, workerism and autonomy in the 1970s: The struggle against unpaid reproductive labour and violence”, online unter: libcom.org/history/italian-feminism-workerism-autonomy-1970s-struggle-against-unpaid-reproductive-labour-vi
(2) Mariarosa Dalla Costa: „The door to the garden: Feminism and Operaismo“
(Vortrag von 2002), online unter libcom.org/library/the-door-to-the-garden-feminism-and-operaismo-mariarosa-dalla-costa
(3) zitiert nach Steve Wright: „Den Himmel stürmen – Eine Theoriegeschichte des Operaismus”, Assoziation A, Berlin/Hamburg 2005, S. 146.
(4) Leopoldina Fortunati: „Learning to struggle: My story between workerism and feminism” libcom.org/library/learning-struggle-my-story-between-workerism-feminism-leopoldina-fortunati
(5) Mariarosa Dalla Costa: „Women and the subversion of the community”, www.commoner.org.uk
(6) vgl. www.citsee.eu/interview/organising-and-living-interview-silvia-federici
(7) Silvia Federici: „Wages Against Housework”, http://caringlabor.wordpress.com/2010/09/15/silvia-federici-wages-against-housework/
(8) zitiert nach Patrick Cuninghame, a.A.o.
Operaismus für Anfänger*innen (Teil 6)
Im „Heißen Herbst“ von 1969 schien Italien kurz vor einer Revolution zu stehen. Eine Welle von wilden Streiks, deren Epizentrum die Fabriken des Autokonzerns FIAT in Turin waren, erschütterte die herrschende Ordnung. Dies habe ich im vorletzten Teil dieser Artikelreihe beschrieben. Im letzten Heft habe ich mich dann vor allem mit der feministischen Gruppe Lotta Femminista beschäftigt. Indem sie auch die „revolutionären“ linksradikalen Großorganisationen – wie z.B. Potere Operaio und Lotta Continua – einer systematischen Kritik aussetzten, spielten gerade die Feministinnen eine wichtige Vorreiterrolle bei der Entstehung der neuen neuen autonomen Bewegung der 1970er Jahre.
Mit eben dieser neuen Bewegung, der „Autonomia“, die 1977 erneut eine politische Krise von ungeahnten Ausmaßen hervorrufen sollte, werde ich mich nun im letzten Teil dieser Reihe befassen. Genauer gesagt, soll hier gezeigt werden, wie die operaistischen Theoretiker*innen versuchten, diesen neuen Zyklus von sozialen Kämpfen zu erfassen und verständlich zu machen. Einen ersten Eindruck davon, wie schwierig das war, mag diese Äußerung des operaistischen Historikers Sergio Bologna geben: „Die 1977er Bewegung […] war eine neue und interessante Bewegung, da sie erstens nicht wirklich Wurzeln in vorhergehenden Bewegungen hatte, oder falls sie sie hatte, auf eine vielschichtige Art und Weise. Sie hatten eindeutig eine andere soziale Basis, die sich von jener der Bewegungen von 1968 und 1973 unterschied. Ihre soziale Zusammensetzung basierte auf einer Jugend, die mit den politischen Eliten, inklusive den Eliten von 1968, also auch mit den Gruppen wie Lotta Continua und selbst der Autonomia Organizzata gebrochen hatte oder sie zurückwies. […] Sie brach völlig mit der Vision des Kommunismus, während letztlich auch der Operaismus von sich dachte, er sei der Vertreter des ‘wahren Kommunismus’. Die 77er Bewegung wollte absolut nicht der ‘echte Kommunismus’ sein.“ (1)

Die neue Bewegung bewegte sich also einerseits in den Fluchtlinien der Klassenkämpfe von 1969, aber zugleich taten sich neue Konfliktfelder auf und neue Akteure traten auf den Plan – die feministische Bewegung habe ich bereits erwähnt, hinzu kamen Jugendliche, Arbeitslose und prekär Beschäftigte, Hausbesetzer*innen usw. Auf die Frage, wie sich diese vielfältige Bewegung begrifflich erfassen ließe, fanden die operaistischen Theoretiker*innen recht unterschiedliche Antworten, wobei ich hier beispielhaft zwei davon behandeln will: den bereits erwähnten Sergio Bologna sowie Antonio Negri.
Beide teilten eine lange gemeinsame Geschichte (beide waren bei der Organisation Potere Operaio aktiv gewesen, Negri hatte dort zeitweilig den Posten des Generalsekretärs inne), entwickelten sich aber von da aus in sehr unterschiedliche Richtungen – polemisch gesagt, vertrat Bologna den „rationalen“ Flügel der operaistischen Bewegung, während Negri eher den „irrationalen“ verkörperte. Nach der Auflösung von Potere Operaio 1973 begründete Sergio Bologna die Zeitschrift Primo Maggio („Erster Mai“) mit. Im Folgenden beziehe ich mich vor allem auf seinen Text „Der Stamm der Maulwürfe“ (2), der im Frühjahr 1977 in Primo Maggio veröffentlicht wurde. Im Anschluss daran werde ich mich dann Negris Geschichtsphilosophie und dem von ihm entdeckten neuen Klassensubjekt des „gesellschaftlichen Arbeiters“ widmen.
Bezahlt wird nicht!
Das italienische Kapital und der Staatsapparat sahen sich durch die Klassenkämpfe von 1969 bis 1973 unter Druck gesetzt. Während die sozialen Kämpfe „von unten“ weitergingen, versuchte man „von oben“ demgegenüber das System neu zu strukturieren und die allgemeine „Krise“ zu lösen. Soweit es die Politik betraf, liefen diese Versuche auf eine Neuordnung des Parteiensystems hinaus vor allem auf eine stetige Annäherung zwischen der PCI (der kommunistischen Partei) und der christdemokratischen Regierungspartei DC, die bis dahin alles getan hatte, um die Kommunisten von der Macht fernzuhalten. Vor allem der DC-Politiker Aldo Moro bemühte sich, diesen „historischen Kompromiss“ zustande zu bringen.
In ökonomischer Hinsicht machten sich ab 1974 die Folgen der sogenannten „Ölkrise“ auch in Italien bemerkbar. Das Kapital nutzte die Krisensituation in seiner Weise – so bot die Inflation eine Möglichkeit, über Preissteigerungen die von den Arbeiter*innen erkämpften Lohnzuwächse abzufangen (in manchen Industriezweigen hatten zuvor die Belegschaften mit ihren Streiks Lohnerhöhungen von 25% pro Jahr durchsetzen können). Zugleich betrieb die christdemokratische Regierung eine rigide Austeritätspolitik und erhöhte u.a. die Gebühren für Strom, Wasser und Telefongebühren.
Dies führte – zusammen mit den allgemein steigenden Lebenshaltungskosten – zu neuen Unruhen, einer landesweiten Bewegung, die sich neuer Aktionsformen bediente. Den Anfang machten dabei die Arbeiter*innen der FIAT-Werke in Turin. Nachdem zwei lokale Busgesellschaften beschlossen hatten, die Fahrpreise um 20 bzw. 50% zu erhöhen, kam es zum Protest, der auch von den Gewerkschaften unterstützt wurde. Die Zahlung der neuen Preise wurde kollektiv verweigert, stattdessen fuhr in jedem Bus ein Gewerkschaftsmitglied mit und kassierte von den Arbeiter*innen (gegen Quittung) die alten Fahrpreise ein – dieses Geld wurde dann gesammelt an die Busgesellschaften überwiesen. Nachdem sich auch die FIAT-Konzernleitung einschaltete und Druck ausübte, kehrten die Busgesellschaften zu den alten Preisen zurück (4).
Indem sie so auf das Mittel der „direkten Aktion“ setzten, zeigten die Gewerkschaften auch, dass sie aus den Erfahrungen des „Heißen Herbstes“ gelernt hatten. Der Protest in Turin erwies sich jedenfalls als beispielgebend: Ähnliche Praktiken der „eigenmächtigen Herabsetzung“ (autoriduzione) fand bald in vielen, vor allem norditalienischen Städten massenhafte Anwendung. Nicht nur wurden in Städten wie Rom, Mailand und Neapel tausende Häuser besetzt. Zugleich entwickelte sich eine breite Bewegung der Mieter*innen, welche die überhöhten Mieten zurückwiesen und eigenmächtig reduzierten.
Auch als Mittel, um sich gegen die Erhöhung der Strom- und Telefongebühren zu wehren, war die „eigenmächtige Herabsetzung“ sehr beliebt. In Rom wurden diese Kämpfe von Aktivisten der autonomen Szene unterstützt, von denen relativ viele bei den städtischen Elektrizitätswerken beschäftigt waren – wenn wegen der Zahlungsverweigerung irgendwo der Strom abgestellt worden war, kamen sie vorbei und setzten die Stromversorgung wieder in Gang. In denselben Zusammenhang gehörten auch der „proletarische Einkauf“, wie er im Oktober 1974 in Mailand erstmals praktiziert wurde, wo eine Gruppe von wütenden Hausfrauen einen Supermarkt stürmte und die Herausgabe von Waren zu reduzierten Preisen erzwang.

Die Rolle der kleinen Fabriken
Die wirtschaftliche Krise trug aber noch in anderer Weise dazu bei, dass sich das Terrain der Kämpfe verlagerte. So wurden einerseits eine ganze Reihe von Fabriken geschlossen oder zeitweise stillgelegt. Zugleich schossen Unmengen an kleinen „Klitschen“-Betrieben aus dem Boden. Das Textilunternehmen Benetton war dabei besonders innovativ, indem er gleich seine gesamte Produktion an solche formell unabhängige Kleinunternehmen übertrug – wobei freilich der „Mutterkonzern“ nach wie vor eine sehr direkte Kontrolle z.B. über die Arbeitsgeschwindigkeit an den Fließbändern ausübte.
Während diese Klitschenbetriebe zunehmend das Bild der italienischen Wirtschaft bestimmten, änderte sich zugleich die Zusammensetzung der Arbeiterschaft. So waren in diesem Sektor überproportional viele Minderjährige und Jugendliche beschäftigt, ebenso sehr viele weibliche Arbeitskräfte. Die wenigsten von diesen war gewerkschaftlich organisiert – überhaupt ließen sich viele gewerkschaftliche Methoden, die in der Großfabrik wunderbar funktionierten, in den Kleinbetrieben kaum anwenden.
Diese Umstrukturierung der Produktion und die Umschichtung der Arbeiterschaft stellte aber keineswegs nur eine „von oben“, von Seiten des Kapitals betriebene Strategie dar. Für viele proletarische Jugendliche war die selbstgewählte Prekarität und die zeitweilige, immer wieder unterbrochene Beschäftigung in Teil-, Saison- oder Schwarzarbeit auch ein Mittel, sich gewisse Freiheiten zu sichern – eine Festanstellung in der Fabrik stellte schließlich kaum eine wünschenswerte Perspektive dar. Die autonome Szene in Bologna baute sogar eine Art selbstorganisierte Arbeitsvermittlung auf. Die Arbeitssuchenden der Region wurden in einer Liste erfasst, und dann die Stadtverwaltung (die damals von der kommunistischen Partei gestellt wurde) dahingehend unter Druck gesetzt, dass sie entsprechende Jobs vergab. Arbeit in der Fabrik oder auf dem Bau wurde von den Autonomen dabei prinzipiell verweigert. Zeitweise waren um die 5.000 Personen in dieser Liste organisiert. (5)
Sergio Bologna sah in den kleinen Fabriken ein mögliches Terrain, von dem ausgehend sich eine neue Klassenbewegung entwickeln könnte. Während die Belegschaften der Großbetriebe sich eher still hielten, um angesichts der vielbeschworenen Wirtschaftskrise ihre eigene Position nicht zu gefährden, schien bei den Arbeiter*innen der Klitschen eine größere Konfliktbereitschaft gegeben zu sein. Allerdings wies Bologna auch darauf hin, dass die Kleinbetriebe untereinander große Unterschiede aufwiesen: Unterschiede in der technischen Ausstattung, der Märkte, die jeweils beliefert wurden, des gewerkschaftlichen Organisationsgrades der Belegschaft, zwischen unausgebildeten und schlecht bezahlten Beschäftigten und solchen, die hochspezialisierte anspruchsvolle Tätigkeiten ausübten…
Negri und der „gesellschaftliche Arbeiter“
Um das Folgende verständlich zu machen, müssen wir uns noch einmal die operaistische Theoriegeschichte, und dort vor allem das Konzept der „Klassenzusammensetzung“ anschauen. Dieses Konzept hatten die Operaist*innen Anfang der 60er Jahre bei ihren „militanten Untersuchungen“ in den Fabriken von FIAT und OLIVETTI entwickelt.
Auch damals befand sich die italienischen Industrie in einer Phase der Umstrukturierung: Durch zunehmende Automatisierung und Ausweitung der Fließbandarbeit wurde die ältere Generation der Facharbeiter unter Druck gesetzt – deren Fähigkeiten und Kenntnisse wurden durch die technische Entwicklung zunehmend überflüssig gemacht. Das brachte auch eine schwere Krise der Gewerkschaften mit sich, deren Mitglieder sich vorrangig aus der Facharbeiterschaft rekrutierten. Das bedeutete freilich nicht, dass nun völlige Ruhe herrschte: Vielmehr kam es um 1960 zu einer ganzen Reihe von wilden Streiks, wobei die Initiative gerade von den ungelernten und nicht gewerkschaftlich organisierten jüngeren Arbeiter*innen ausging. Diese „Massenarbeiter“ – meist junge Männer, die aus dem Süden des Landes in die Industrieregionen im Norden abgewandert waren – standen dann auch im Zentrum des „Heißen Herbstes“ von 1969.
Darauf aufbauend entwickelten die Operaist*innen den Begriff der „Klassenzusammensetzung“, um die Ereignisse analytisch zu fassen. Diesem Konzept zufolge gab es eine bestimmte „technische Zusammensetzung“ des Kapitals, die von oben her, durch eine neuen Organisation der Produktionsabläufe und Einführung neuer Technologie durchgesetzt wurde. Dieser entsprach jeweils auch eine bestimmte „politische Zusammensetzung“ der Arbeiterschaft, ein bestimmtes zentrales Arbeitersubjekt mit spezifischen Formen des widerständigen Verhaltens.Mit diesem Schema ließen sich die Klassenkämpfe der 1960er Jahre ziemlich gut analysieren.
Hier kommen wir zu Antonio Negri: Dieser verpasste dem Konzept einen recht eigenwilligen Dreh und interpretierte es im Sinne einer breit angelegten Geschichtsphilosophie, deren zentrale Annahmen schon Mitte der 60er von Mario Tronti formuliert worden waren. Für Tronti war „die kapitalistische Entwicklung den Arbeiterkämpfen untergeordnet, sie kommt nach ihnen“ (6). Die Arbeiter*innen waren demzufolge dem Kapital also immer einen Schritt voraus, und dieses konnte nur reagieren, indem es – mittels neuer Technologie und Umstrukturierung – seine Macht wieder herzustellen suchte.
Dieser Prozess lief für Tronti zwangsläufig auf die Revolution hinaus, denn: „Begriff der Revolution und Wirklichkeit der Arbeiterklasse sind […] identisch.“ (7) Die Arbeiter_innen hatten also schlicht keine andere Wahl.
Negri knüpfte daran an, und damit ließ sich die Frage, wie die veränderte Lage Mitte der 70er zu bewerten seien, mit einem einfachen Analogieschluss beantworten: Die Umstrukturierung der Produktion zeigte, dass da eine neue Klassenzusammensetzung am Entstehen war, und somit musste dabei auch eine neue zentrale Arbeiterfigur als revolutionäres Subjekt entstehen – der „gesellschaftliche Arbeiter“, wie Negri ihn nannte. Dieser hätte nicht nur das Erbe des alten „Massenarbeiters“ übernommen, sondern würde es vielmehr auf einem weitaus höheren Niveau fortführen: Die Klassenkämpfe seien nun eben nicht mehr auf die Fabrik beschränkt, sondern würden sich vielmehr über das gesamte gesellschaftliche Territorium ausbreiten. Somit müsse man „die Restrukturierung als Herausbildung eines immer breiteren vereinheitlichenden Potentials von Kämpfen verstehen“. (8) Diese Thesen formulierte Negri Mitte 1975 in seinem Text „Proletari e Stato“ („Proletarier und Staat“) aus.
Sergio Bologna sprach stattdessen vom „zerstreuten Arbeiter“, was nicht nur weitaus vorsichtiger, sondern auch deutlich realistischer war. Realistischer deshalb, weil Diagnose und Prognose nun mal zwei verschiedene Sachen sind – zumal sich eine wirklich revolutionäre Situation nicht einfach so prognostizieren, also aus dem Ist-Zustand ableiten lässt.
Es ist also nicht verwunderlich, dass Negris Thesen auf Widerspruch stießen. So kritisierte Guido De Masi in einem Artikel, der 1977 in der Zeitschrift Primo Maggio erschien, dass Negri letztlich nur „widersprüchliche Bruchstücke sprachlich ver-eindeutigt“, also „die verschiedenen Kämpfe und gesellschaftlichen Situationen (die alle sehr interessant sind, gerade weil sie so verschieden voneinander sind)“ lediglich unter einem gemeinsamem Schlagwort zusammenfasse. Tatsächlich gäbe es kein neues Klassensubjekt, all diese Kämpfe hätten keinen engeren Zusammenhang: „Sie stellen keinen qualitativen Sprung in der Klassenzusammensetzung dar, sondern ihre Desintegration, Punkt und basta.“ (9)
Auch Sergio Bologna zeigte sich eher skeptisch, und wies auf die Widersprüche und Gegentendenzen hin, die bei Negri gar nicht auftauchten: „Es hat viele kleine (oder große) Schlachten gegeben, aber im Laufe dieser Schlachten hat sich die politische Zusammensetzung der Klasse in den Fabriken wesentlich verändert, und zwar mit Sicherheit nicht in die Richtung, die Negri andeutet. Es gibt keine Tendenz zu jener größeren Einheit, von der er redet, das Gegenteil ist der Fall. Der Graben ist tiefer geworden: nicht zwischen Fabrik und Gesellschaft, sondern innerhalb der Fabrik selbst, zwischen der Rechten und der Linken in der Arbeiterklasse. Alles in allem haben die Reformisten die Hegemonie über die Fabriken zurückgewonnen und versuchen, brutal und rücksichtslos die Klassenlinke zu enthaupten und aus der Fabrik zu vertreiben.“ (10)
This is not the end…
An dieser Stelle schalte ich mal den Zeitraffer ein – eine erschöpfende Geschichte der autonomen Bewegung der 70er Jahre ist auf diesem beschränkten Raum allemal nicht möglich. Das Jahr 1977 brachte, wie erwähnt, eine politische Krise mit sich, in der eine Revolution tatsächlich in greifbarer Nähe zu sein schien. Im Frühjahr des Jahres besetzten autonome Gruppen z.B. die komplette Altstadt von Bologna – der kommunistische Bürgermeister musste schließlich die Armee zur Hilfe rufen, die mit Panzern einrückte, um die Revolte unter Kontrolle zu bringen. Eine Welle von Universitätsbesetzungen, Demonstrationen und Straßenschlachten folgte.

Nachdem dann im Frühjahr 1978 der christdemokratische Politiker Aldo Moro von der Stadtguerilla-Gruppe Rote Brigaden entführt und schließlich ermordet worden war, nutzte der Staat die Möglichkeit, um auf breiter Front gegen die vermeintlichen „Rädelsführer“ der radikalen Linken vorzugehen. Am 7. April 1979 begannen massenhafte Razzien, bei denen neben vielen anderen auch Antonio Negri verhaftet wurde. Er saß vier Jahre lang im Gefängnis, ehe ihm die Flucht nach Frankreich gelang.
Sein weiterer Werdegang dürfte halbwegs bekannt sein: Spätestens mit seinem 1999 erschienenen Theorie-Bestseller „Empire“, den er zusammen mit Michael Hardt verfasste, brachte Negri es zu weltweiter Berühmtheit. Seinen Überzeugungen ist er dabei weitgehend treu geblieben, was sich ebenso positiv wie negativ bewerten lässt: Einerseits ist ist es schon phänomenal, wie Negri sich seit Jahrzehnten an jede neue Protestwelle, von der Öko-Bewegung bis zu Occupy anhängt. Andererseits hat seine Theorie sich auch kaum weiterentwickelt, sondern ist nur noch allgemeiner und ungenauer geworden – so ist die heute von ihm gefeierte „Multitude“ leicht als verwässerte Neuauflage des „gesellschaftlichen Arbeiters“ zu erkennen.
Das ist nicht weiter schlimm – der Negrische „(Post-)Operaismus“ ist im Feuilleton und in universitären Soziologie-Seminaren bestens aufgehoben. Ansonsten sollte man eher das Gegenteil von dem tun, was Negri zwar schmissig, aber wie üblich einigermaßen falsch, schon 1981 empfahl – nämlich großzügig zu vergessen: „Die Klassenzusammensetzung des heutigen metropolitanen Subjekts kennt keine Erinnerung, […] weil es befohlene Arbeit, dialektische Arbeit nicht will […], proletarische Erinnerungen sind nur Erinnerungen an vergangene Entfremdung […]. Die bestehenden Erinnerungen an 1968 und an die zehn Jahre danach sind heute nur noch die Erinnerungen des Totengräbers […] Die Jugendlichen von Zürich, die Proletarier von Neapel und die Arbeiter von Danzig brauchen keine Erinnerung, […] kommunistischer Übergang bedeutet die Abwesenheit der Erinnerung.“ (11) Das ist keine gute Idee. In der offiziellen Geschichtsschreibung werden die sozialen Kämpfe der Vergangenheit ohnehin allemal als erstes vergessen.
Und natürlich will ich hier Negri nicht das letzte Wort überlassen. Immerhin ist sein Werdegang symptomatisch. Der Operaismus war eben nie eine einheitliche Bewegung, und die Aktivist*innen schreckten oft davor zurück, aus ihren radikalen Ansätzen auch die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen: So führte ihre entschiedene Parteinahme für die Arbeiter*innen und deren Kämpfe von unten und gegen die Institutionen der offiziellen „Arbeiterbewegung“ für viele von ihnen (mit einigen Umwegen) dann doch wieder zur Parteipolitik zurück. Die Praxis der „militanten Untersuchung“ und die kleinteilige Analyse der Verhältnisse in den Fabriken, die sich daraus ergab, wurde zugunsten einer großspurigen Geschichtsphilosophie fallen gelassen.
Demgegenüber sollten die positiven Ansätze des Operaismus natürlich nicht vergessen werden – in den vorangegangenen Teilen dieser Artikelserie habe ich dazu hoffentlich ein wenig beigetragen. Vor allem sollte man nicht vergessen, dass Staat und Kapital niemals die einzigen Subjekte der Geschichte waren und es auch heute nicht sind. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende.
Fussnoten Teil 6:
(1) http://www.copyriot.com/unefarce/no5/autonomia.html
(2) englische Version unter http://libcom.org/library/tribe-of-moles-sergio-bologna
(3) Austerität: von lat. austeritas „Herbheit“, „Strenge“, bezeichnet eine staatliche Haushaltspolitik, die einen ausgeglichenen Staatshaushalt ohne Neuverschuldung anstrebt.
(4) vgl. www.trend.infopartisan.net/trd0513/t060513.html
(5) vgl. www.wildcat-www.de/thekla/08/t08akmu1.htm
(6) Mario Tronti, „Lenin in England“, zitiert nach Nanni Ballestrini/Primo Moroni: „Die goldene Horde – Arbeiterautonomie, Jugendrevolte und bewaffneter Kampf in Italien“, Assoziation A, Berlin 2002, S. 87
(7) zitiert nach Bodo Schulze: „Autonomia – Vom Neoleninismus zur Lebensphilosophie. Über den Verfall einer Revolutionstheorie“, in: Archiv für die Geschichte des Widerstandes und der Arbeit, No. 10, 1989, S. 151 (online unter www.wildcat-www.de/material/m009schul.htm)
(8) zitiert nach Steve Wright: „Den Himmel stürmen. Eine Theoriegeschichte des Operaismus“, Assoziation A, 2005, S. 178.
(9) zitiert nach Roberto Battaggia: „Massenarbeiter und gesellschaftlicher Arbeiter – einige Bemerkungen über die neue Klassenzusammensetzung“, Wildcat-Zirkular Nr. 36/37, April 1997, online unter www.wildcat-www.de/zirkular/36/z36batta.htm
(10) zitiert nach Wright, a.A.o., S. 184.
(11) zitiert nach Wright, S. 188.


